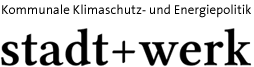Interview:
Klimaschutz im Fokus der Politik
[25.9.2019] Wie die Bundesregierung auf aktuelle Diskussionen über den Klimaschutz reagiert, erläutert Energiestaatssekretär Andreas Feicht im stadt+werk-Interview. Der frühere Chef der Wuppertaler Stadtwerke sagt auch, welche Forderungen seine ehemaligen Kollegen stellen.
 Herr Staatssekretär Feicht, spätestens seit den Fridays-for-Future-Demonstrationen stehen Klimaschutz und Energiewende wieder oben auf der Agenda. Welche Auswirkungen hat dies auf die deutsche Energiepolitik?
Herr Staatssekretär Feicht, spätestens seit den Fridays-for-Future-Demonstrationen stehen Klimaschutz und Energiewende wieder oben auf der Agenda. Welche Auswirkungen hat dies auf die deutsche Energiepolitik?Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Themen Klimaschutz und Energiewende die Menschen bewegen. Beides ist in der Politik wieder stärker in den Fokus gerückt. Die Bundesregierung hat im Frühjahr dieses Jahres das Klimakabinett eingerichtet. Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kommen alle betroffenen Ministerinnen und Minister in regelmäßigen Abständen zusammen, um auf höchster politischer Ebene zu entscheiden, wie wir unsere Klimaziele erreichen. Aktuell bereitet das Klimakabinett ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 vor. Ziel ist es, im September eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen zu treffen, die dann schnellstmöglich umgesetzt werden soll.
Wie können die Ausbauziele bei erneuerbaren Energien erreicht werden?
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch lag 2018 bei rund 38 Prozent. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Selbstverständlich dürfen wir nicht nachlassen, um unser Ziel von 65 Prozent bis 2030 zu erreichen. Das Energiesammelgesetz legt fest, dass wir von 2019 bis 2021 die Ausschreibungsmengen für Windenergie an Land und Solaranlagen um je vier Gigawatt erhöhen. Zusätzlich führen wir im gleichen Zeitraum technologieneutrale Innovationsausschreibungen durch. Um weitere Maßnahmen zu erarbeiten, haben die Koalitionsfraktionen die Arbeitsgruppe Akzeptanz eingerichtet. Hier besprechen die Abgeordneten zentrale Themen, die für die Zielerreichung notwendig sind.
Wie kann aus Ihrer Sicht die Akzeptanz beim Netzausbau erhöht werden?
Der Um- und Ausbau unseres künftigen Stromnetzes kann nur gelingen, wenn wir ihn gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort angehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich seit seinem Amtsantritt intensiv mit Netzausbaufragen beschäftigt und bei seinen Netzausbaureisen auch vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Bereits seit Längerem gibt es die vom BMWi ins Leben gerufene Initiative Bürgerdialog Stromnetz, die neben den Genehmigungsbehörden und Vorhabenträgern als weiterer Akteur Informationen und Gespräche zu Fragen des Netzausbaus anbietet. Auch der Einsatz alternativer Technologien wie Erdkabel oder bestimmte Masttypen können einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz des Stromnetzausbaus leisten. Bei der Diskussion um den Netzausbau geht es daher häufig um die Frage nach der besten Technik, die die Auswirkungen vor Ort reduziert und Umwelteingriffe vermindert.
„Klimaschutz und Energiewende bewegen die Menschen.”
Kommunen und Stadtwerke spielen beim Klimaschutz und der Energiewende vor Ort eine zentrale Rolle. Wie kann deren Position durch energiepolitische Maßnahmen gestärkt werden?
Ein entscheidender Faktor ist die Akzeptanz energie- und klimapolitischer Maßnahmen vor Ort. Viele Kommunen sind beispielsweise unmittelbar vom Netzausbau oder dem Bau neuer Windkraftanlagen betroffen. Es zählt zu unseren vordringlichen Aufgaben, den Dialog auf Augenhöhe zu suchen. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den kommunalpolitisch Verantwortlichen die Planungs- und Entscheidungsprozesse transparent und verständlich machen und Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen. Energieeffizienz ist eines der zentralen Elemente, damit wir unsere Energie- und Klimaziele erreichen. Schon heute richten sich viele Förderangebote im Bereich der Energieeffizienz an Kommunen. Auch eine umweltfreundliche Mobilität sowie die Planung und der Bau von Wärmenetzen sind wichtige Themen für die Kommunen. Die meist von Stadtwerken betriebenen Wärmenetze bieten ideale Voraussetzungen für die Einbindung erneuerbarer Energien und Sektorkopplungstechnologien in die Wärmeversorgung. Die Stadtwerke haben dabei den Vorteil, dass sie in verschiedenen Bereichen tätig sind, die künftig stärker zusammenwachsen werden: Strom, Wärme und Verkehr. Ihre Stärke liegt in übergreifenden Lösungen, die unterschiedliche Aspekte der Energieversorgung verknüpfen. Dabei wird auch die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen.
Sie waren viele Jahre Chef der Wuppertaler Stadtwerke und auch Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen. Welche Forderungen haben ehemalige Stadtwerke-Kollegen an Sie gerichtet?
Allem voran steht die Forderung nach einer konsistenten Energiepolitik. Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Längst nicht alle sind auf die Energiewende zurückzuführen. Die Digitalisierung erzeugt branchenübergreifend einen hohen Anpassungsdruck. Hinzu kommt eine andere Erwartungshaltung der Kunden. Allerdings warne ich ausdrücklich vor der Annahme, dass die Energiewende nur dann gelingen kann, wenn wir einen Masterplan haben. Niemand weiß, welche Technologie in 15 oder 20 Jahren die richtige sein wird. Unternehmen, die sich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen, die sich neuen Entwicklungen nicht verschließen und die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen, werden auch in Zukunft gut dastehen.
Was hat Sie an der neuen Aufgabe als Energiestaatssekretär besonders gereizt?
Die Energiepolitik ist ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld, das zudem von großen Veränderungen geprägt ist. Diese mitgestalten zu dürfen ist ein großes Privileg.
Interview: Alexander Schaeff
Feicht, Andreas
Andreas Feicht ist seit Februar 2019 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Zuvor war er Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG (vormals Wuppertaler Stadtwerke AG). Seine berufliche Karriere startete der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei den Dresdner Verkehrsbetrieben.
Andreas Feicht ist seit Februar 2019 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Zuvor war er Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG (vormals Wuppertaler Stadtwerke AG). Seine berufliche Karriere startete der studierte Wirtschaftswissenschaftler bei den Dresdner Verkehrsbetrieben.
https://www.bmwi.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe September/Oktober 2019 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Klimaschutz, Politik
Bildquelle: BMWi
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Klimaschutz
Brandenburg: Start einer Online-Beteiligung
[24.6.2024] Vom 25. Juni bis zum 15. Juli haben in Brandenburg Bürgermeister, Landräte, Amtsdirektoren und Klimaschutz-Manager die Möglichkeit, in einer Umfrage und einem Dialogbereich ihre Bedarfe und Erfahrungen mitzuteilen. mehr...
[24.6.2024] Vom 25. Juni bis zum 15. Juli haben in Brandenburg Bürgermeister, Landräte, Amtsdirektoren und Klimaschutz-Manager die Möglichkeit, in einer Umfrage und einem Dialogbereich ihre Bedarfe und Erfahrungen mitzuteilen. mehr...
Metropolregion Nürnberg: Emissionen müssen schneller sinken
[14.6.2024] Die Metropolregion Nürnberg hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um ein Drittel reduziert. Dies reicht jedoch nicht aus, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die CO2-Reduktion muss von derzeit 3,7 auf 5,1 Prozent pro Jahr gesteigert werden. mehr...
[14.6.2024] Die Metropolregion Nürnberg hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um ein Drittel reduziert. Dies reicht jedoch nicht aus, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die CO2-Reduktion muss von derzeit 3,7 auf 5,1 Prozent pro Jahr gesteigert werden. mehr...
Schleswig-Holstein: Fahrplan zur Klimaneutralität
[12.6.2024] In Schleswig-Holstein haben sich die Stadtwerke Flensburg, Kiel und Neumünster sowie das Energiewendeministerium jetzt auf einen gemeinsamen Fahrplan zur Transformation der Energieproduktion geeinigt. Damit wollen sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen. mehr...
[12.6.2024] In Schleswig-Holstein haben sich die Stadtwerke Flensburg, Kiel und Neumünster sowie das Energiewendeministerium jetzt auf einen gemeinsamen Fahrplan zur Transformation der Energieproduktion geeinigt. Damit wollen sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen. mehr...
Baden-Württemberg: Landesgebäude sparen Energie
[6.6.2024] Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg 359 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung an landeseigenen Gebäuden umgesetzt. Dazu zählen Maßnahmen zur besseren Wärmedämmung, zur Optimierung technischer Anlagen, LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen und Heizungserneuerungen. mehr...
[6.6.2024] Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg 359 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung an landeseigenen Gebäuden umgesetzt. Dazu zählen Maßnahmen zur besseren Wärmedämmung, zur Optimierung technischer Anlagen, LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen und Heizungserneuerungen. mehr...
Hamburg: Museen reduzieren CO2-Verbrauch
[6.6.2024] Das Hamburger Projekt Elf zu Null kann zwei Jahre nach seinem Start erste Erfolge verzeichnen. In ihm haben sich vor zwei Jahren elf Kultureinrichtungen zusammengetan, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. mehr...
[6.6.2024] Das Hamburger Projekt Elf zu Null kann zwei Jahre nach seinem Start erste Erfolge verzeichnen. In ihm haben sich vor zwei Jahren elf Kultureinrichtungen zusammengetan, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. mehr...