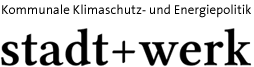Energiekommune:
Fulda nutzt Abwasser und Abwärme
[30.4.2024] Fulda erarbeitet zurzeit ein Nachfolgekonzept für ihr Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2013. Die Energie-Kommune des Monats setzt auf Beteiligung der Bevölkerung bei achtsamer und innovativer Nutzung der Ressourcen wie etwa die Wärmegewinnung aus Abwasser und Abwärme.
 In Osthessen am gleichnamigen Fluss liegt die Stadt Fulda. Die 70.000 Einwohner zählende Kommune engagiert sich seit den 1990er-Jahren im Klimaschutz und erarbeitet derzeit einen Nachfolger für das 200-seitige, 51 Handlungsempfehlungen umfassende Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2013. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zeichnete im April daher die Stadt Fulda als Energie-Kommune des Monats aus. Über allem schwebt dabei das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. „Klimaschutz ist kein endender Vorgang“, so AEE-Geschäftsführer Robert Brandt. „Vielmehr ist Klimaschutz ein stetiger Prozess, der in alle Facetten der Verwaltung, des täglichen Lebens, der Arbeitswelt vordringt.“
In Osthessen am gleichnamigen Fluss liegt die Stadt Fulda. Die 70.000 Einwohner zählende Kommune engagiert sich seit den 1990er-Jahren im Klimaschutz und erarbeitet derzeit einen Nachfolger für das 200-seitige, 51 Handlungsempfehlungen umfassende Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2013. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zeichnete im April daher die Stadt Fulda als Energie-Kommune des Monats aus. Über allem schwebt dabei das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. „Klimaschutz ist kein endender Vorgang“, so AEE-Geschäftsführer Robert Brandt. „Vielmehr ist Klimaschutz ein stetiger Prozess, der in alle Facetten der Verwaltung, des täglichen Lebens, der Arbeitswelt vordringt.“Der Gesamtenergiebedarf Fuldas beläuft sich auf 3.150 Gigawattstunden (GWh). Umso drängender ist es, die eigenen Potenziale stärker zu heben. Diese liegen durch Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei immerhin 1.013 GWh, wie die Potenzialanalyse der Stadt zeigt. Richtungsweisende Projekte helfen, die Potenziale zu nutzen.
Wertvolles Abwasser
Das Löhertor-Quartier beispielsweise umfasst rund 30.000 Quadratmeter Nutzfläche. Die Energie für das Quartier wird aus Abwasser gewonnen. Dieses hier fließende Abwasser wird in einer Schachtsiebanlage gefiltert, bevor es einem Wärmetauscher im Keller des neuen Finanzamts zugeführt wird. Hier wird dem selbst im Winter acht bis elf Grad warmen Abwasser Energie entzogen, die wiederum die Soleflüssigkeit im Wärmetauscher erwärmt. Im Anschluss daran wird die Temperatur der Soleflüssigkeit mittels einer durch eine Photovoltaikanlage (PV) betriebenen Wärmepumpe auf 48 bis 58 Grad Celsius erwärmt. Im Sommer kann die aus dem 16 bis 18 Grad Celsius warmen Abwasser gewonnene Energie als Wärmesenke zum Kühlen des Quartiers genutzt werden. Insgesamt stehen so 600 Kilowatt (kW) Leistung zum Heizen und 400 kW Leistung zum Kühlen zur Verfügung. Den Strom bezieht es neben weiteren PV-Anlagen auf den einzelnen Gebäuden durch ein Blockheizkraftwerk, das mit Biomethan betrieben wird. Damit ergibt sich für das Quartier Löhertor ein Primärenergiefaktor von 0,00 – die benötigte Energie wird komplett CO2-neutral über die gesamte Lieferkette bereitgestellt.
Alles kann genutzt werden
Der Großteil des eingesetzten Biomethans stammt aus der mit Bioabfällen arbeitenden Biogas-Anlage Am Finkenberg. Das dort umgewandelte Biomethan wird ins Erdgasnetz gespeist. Eine Nass- und eine Trockenvergärung produzieren rechnerisch Biomethan für Heizenergie von 2.400 Haushalten. Eingesetzt werden kann das Methan darüber hinaus auch für Strom- und Prozesswärme in Gasturbinen, zum Betanken von Erdgasfahrzeugen und zur Aufbereitung von Warmwasser. Photovoltaikanlagen auf den Dächern und eine Freiflächenanlage decken den Eigenbedarf der Anlage und speisen erneuerbaren Strom ins Netz ein.
„Fulda ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Offenheit, Innovation und Vielfältigkeit der Erneuerbaren helfen, Ressourcen effizient zu nutzen“, sagt Brandt. Dies zeige sich auch im nachhaltigen Rechenzentrum der Stadtverwaltung Fulda. Die Kommune setzt hier nicht auf energieintensive Kältemaschinen, sondern auf geothermale Energie. Das Rechenzentrum im umgenutzten Luftschutzbunker macht sich eine Kombination aus Erdkühlung, moderner Freikühlung zur Hot-Spot-Kühlung und Abwärme zunutze. (ur)
Das ausführliche Portrait zur Energie-Kommune des Monats findet sich hier. (Deep Link)
https://www.unendlich-viel-energie.de
Stichwörter: Klimaschutz, Fulda, Abwasser, Abwärme, AEE, Klimakommune
Bildquelle: Stadt Fulda/Bildstürmer
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Klimaschutz
Brandenburg: Start einer Online-Beteiligung
[24.6.2024] Vom 25. Juni bis zum 15. Juli haben in Brandenburg Bürgermeister, Landräte, Amtsdirektoren und Klimaschutz-Manager die Möglichkeit, in einer Umfrage und einem Dialogbereich ihre Bedarfe und Erfahrungen mitzuteilen. mehr...
[24.6.2024] Vom 25. Juni bis zum 15. Juli haben in Brandenburg Bürgermeister, Landräte, Amtsdirektoren und Klimaschutz-Manager die Möglichkeit, in einer Umfrage und einem Dialogbereich ihre Bedarfe und Erfahrungen mitzuteilen. mehr...
Metropolregion Nürnberg: Emissionen müssen schneller sinken
[14.6.2024] Die Metropolregion Nürnberg hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um ein Drittel reduziert. Dies reicht jedoch nicht aus, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die CO2-Reduktion muss von derzeit 3,7 auf 5,1 Prozent pro Jahr gesteigert werden. mehr...
[14.6.2024] Die Metropolregion Nürnberg hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um ein Drittel reduziert. Dies reicht jedoch nicht aus, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die CO2-Reduktion muss von derzeit 3,7 auf 5,1 Prozent pro Jahr gesteigert werden. mehr...
Schleswig-Holstein: Fahrplan zur Klimaneutralität
[12.6.2024] In Schleswig-Holstein haben sich die Stadtwerke Flensburg, Kiel und Neumünster sowie das Energiewendeministerium jetzt auf einen gemeinsamen Fahrplan zur Transformation der Energieproduktion geeinigt. Damit wollen sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen. mehr...
[12.6.2024] In Schleswig-Holstein haben sich die Stadtwerke Flensburg, Kiel und Neumünster sowie das Energiewendeministerium jetzt auf einen gemeinsamen Fahrplan zur Transformation der Energieproduktion geeinigt. Damit wollen sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen. mehr...
Baden-Württemberg: Landesgebäude sparen Energie
[6.6.2024] Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg 359 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung an landeseigenen Gebäuden umgesetzt. Dazu zählen Maßnahmen zur besseren Wärmedämmung, zur Optimierung technischer Anlagen, LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen und Heizungserneuerungen. mehr...
[6.6.2024] Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg 359 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung an landeseigenen Gebäuden umgesetzt. Dazu zählen Maßnahmen zur besseren Wärmedämmung, zur Optimierung technischer Anlagen, LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen und Heizungserneuerungen. mehr...
Hamburg: Museen reduzieren CO2-Verbrauch
[6.6.2024] Das Hamburger Projekt Elf zu Null kann zwei Jahre nach seinem Start erste Erfolge verzeichnen. In ihm haben sich vor zwei Jahren elf Kultureinrichtungen zusammengetan, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. mehr...
[6.6.2024] Das Hamburger Projekt Elf zu Null kann zwei Jahre nach seinem Start erste Erfolge verzeichnen. In ihm haben sich vor zwei Jahren elf Kultureinrichtungen zusammengetan, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. mehr...