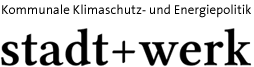Wuppertal:
Wärmezentrale in Betrieb genommen
[4.10.2023] Vergangene Woche hat in Wuppertal das Fachforum „Netzdienliche Betriebsführung von Gebäuden“ stattgefunden. Anlässlich der Veranstaltung haben die Wuppertaler Stadtwerke und die Bergische Universität Wuppertal im Living Lab NRW eine Wärmezentrale in Betrieb genommen.
 Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) und die Bergische Universität Wuppertal haben in der vergangenen Woche im Living Lab NRW eine Wärmezentrale zur Versorgung von acht Experimentalhäusern auf dem Forschungscampus am Mirker Bahnhof in Betrieb genommen. Wie die WSW mitteilen, fand die Einweihung im Rahmen des Fachforums Netzdienliche Betriebsführung von Gebäuden" statt. Die Anlage selbst sei ein Forschungsprojekt und versorge die beim Solar Decathlon Europe im vergangenen Jahr errichteten Gebäude mit Strom und Wärme aus Sonnenenergie.
Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) und die Bergische Universität Wuppertal haben in der vergangenen Woche im Living Lab NRW eine Wärmezentrale zur Versorgung von acht Experimentalhäusern auf dem Forschungscampus am Mirker Bahnhof in Betrieb genommen. Wie die WSW mitteilen, fand die Einweihung im Rahmen des Fachforums Netzdienliche Betriebsführung von Gebäuden" statt. Die Anlage selbst sei ein Forschungsprojekt und versorge die beim Solar Decathlon Europe im vergangenen Jahr errichteten Gebäude mit Strom und Wärme aus Sonnenenergie.Die Anlage kombiniere Photovoltaik-Thermik-Kollektoren (PVT-Kollektoren) mit einem Quellenspeicher und einer Wärmepumpe. Die WSW untersuchten die Effizienz dieser Konstellation zur Versorgung von Wohngebäuden. Ziel sei es, daraus Erkenntnisse für die Produktentwicklung abzuleiten. Die WSW wollen ihren Kunden zukünftig verstärkt Lösungen für Strom und Wärme auf Basis erneuerbarer Energien anbieten. Die Kooperation mit dem Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen der Bergischen Universität mit einem eigenen Forschungscampus erweise sich dabei als echter Standortvorteil. Die acht Experimentalhäuser seien von internationalen Studierenden-Teams als Wettbewerbsbeiträge für den Solar Decathlon Europe im vergangenen Jahr entworfen worden. In den Gebäuden seien viele Ideen für nachhaltiges Bauen und Wohnen sowie für eine klimafreundliche Energieversorgung realisiert worden. Diese innovativen Ansätze würden nun durch die von den WSW konzipierte Nahwärmezentrale weitergeführt.
Energie-Mangement
Die sechs verbauten PVT-Module erreichten eine Stromleistung von zusammen 2,7 Kilowatt (kW) und werden nur einen Teil des Energiebedarfs der acht Wohneinheiten abdecken. Bei Bedarf könne eine elektrische Zusatzheizung zugeschaltet werden. Diese würde dann im Rahmen des Forschungsprojekts einen weiteren regenerativen Wärmeerzeuger simulieren.
Ein zweiter wichtiger Forschungsaspekt sei das Energie-Management mit einem netzdienlichen Betriebskonzept. Darin sollen wetterabhängige Wärmeverbrauchsprognosen, die Wärmeverfügbarkeit sowie die aktuellen Strommarktpreise eingehen. In Abhängigkeit von diesen Parametern soll entschieden werden, wie der von der Anlage erzeugte Strom genutzt wird: für den Verdichter der Wärmepumpe, für die Elektroheizung im Pufferspeicher oder zur Einspeisung ins öffentliche Netz? Dafür würden die WSW eine eigene Software entwickeln.
Die WSW sähen jetzt schon viele Vorteile der PVT-Technologie, die in Deutschland noch wenig genutzt wird. Die gemeinsame Nutzung von Solarthermie und Photovoltaik erhöhe die Gesamteffizienz und den Anteil erneuerbarer Energien am Eigenverbrauch. PVT-Module seien platzsparend und könnten flexibel auf Dächern oder Fassaden installiert werden. Besonders geeignet sei die PVT-Technologie für den Einsatz in Gebäuden, die mit niedrigen Temperaturen beheizt werden. Ähnlich wie Erdwärmepumpen arbeiteten PVT-Wärmepumpen geräuschlos und stellten in dicht bebauten Wohngebieten eine Alternative zur Luftwärmepumpe dar.
Experimentierfeld für nachhaltiges Bauen
Der Forschungscampus in Wuppertal Elberfeld, der im vergangenen Jahr Schauplatz des internationalen Architekturwettbewerbs „Solar Decathlon Europe“ war, werde jetzt von der Bergischen Universität Wuppertal als Experimentierfeld für klimaneutrales und nachhaltiges Bauen genutzt. Das Living Lab umfasse knapp 7.000 Quadratmeter und sei direkt an der Nordbahntrasse am Mirker Bahnhof gelegen. Acht so genannte Demonstratoren der studentischen Teams aus Valencia, Taipeh, Delft, Prag, Pécs und Biberach sowie von zwei NRW-Teams aus Aachen und Düsseldorf zeigten unterschiedliche Innovationen, Leitideen und vielfältige Ansätze für zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt.
Die Wuppertaler Stadtwerke waren bereits Partner des Solar Decathlon und haben nun die innovative Wärmezentrale für das Living Lab NRW geplant und realisiert. (th)
https://www.wsw-online.de
https://livinglabnrw.uni-wuppertal.de
Stichwörter: Energieeffizienz, WSW, Bergische Universität Wuppertal, Living Lab NRW
Bildquelle: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Energieeffizienz
enercity : Biomethan-BHKW für Kohleausstieg
[19.6.2024] enercity nimmt ein Biomethan-Heizkraftwerk in Betrieb. Damit rückt der Kohleausstieg in Hannover näher. Die hochflexible Anlage für Spitzenlast produziert erneuerbare Wärme und erneuerbaren Strom. mehr...
[19.6.2024] enercity nimmt ein Biomethan-Heizkraftwerk in Betrieb. Damit rückt der Kohleausstieg in Hannover näher. Die hochflexible Anlage für Spitzenlast produziert erneuerbare Wärme und erneuerbaren Strom. mehr...
Trier: Einheitliche LEDs senken CO2-Ausstoß
[14.6.2024] Seit dem Jahr 2016 stellen die Stadtwerke in Trier die Straßenbeleuchtung auf LED um. Über 78 Prozent der vormals unterschiedlichsten Leuchtentypen sind mittlerweile umgerüstet, der Stromverbrauch hat sich dadurch mehr als halbiert. mehr...
[14.6.2024] Seit dem Jahr 2016 stellen die Stadtwerke in Trier die Straßenbeleuchtung auf LED um. Über 78 Prozent der vormals unterschiedlichsten Leuchtentypen sind mittlerweile umgerüstet, der Stromverbrauch hat sich dadurch mehr als halbiert. mehr...
Mainova: Marktstart für smartes Monitoring
[11.6.2024] Mainova AG und der ABG Frankfurt wollen mit Heatral für effiziente Heizanlagen sorgen. mehr...
[11.6.2024] Mainova AG und der ABG Frankfurt wollen mit Heatral für effiziente Heizanlagen sorgen. mehr...
ITC AG: Brühl nutzt Energie-Management
[30.5.2024] Bereits seit dem Jahr 2021 nutzt die Stadt Brühl die Energie-Managementsoftware von ITC. Mittlerweile hat die Stadt rund 500 Hauptzähler und deren Untermessungen in das Energie-Management eingebunden. mehr...
[30.5.2024] Bereits seit dem Jahr 2021 nutzt die Stadt Brühl die Energie-Managementsoftware von ITC. Mittlerweile hat die Stadt rund 500 Hauptzähler und deren Untermessungen in das Energie-Management eingebunden. mehr...
Baden-Württemberg: Kommunen setzen auf Kom.EMS classic
[8.5.2024] Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg hat gemeinsam mit den Energieagenturen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das Energie-Management-System Kom.EMS classic entwickelt. Derzeit ist das Tool in 150 der 1.136 Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg im Einsatz. mehr...
[8.5.2024] Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg hat gemeinsam mit den Energieagenturen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das Energie-Management-System Kom.EMS classic entwickelt. Derzeit ist das Tool in 150 der 1.136 Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg im Einsatz. mehr...