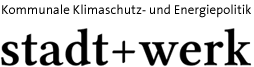Interview:
KWK als grüner Teamplayer
[24.6.2024] In der Energiepolitik fehlt ein klares Bekenntnis zur Kraft-Wärme-Kopplung, sagt Christian Grotholt. stadt+werk sprach mit dem Chef des Anlagenherstellers 2G Energy über die Rolle der KWK im künftigen Energiesystem.
 Herr Grotholt, findet die Kraft-Wärme-Kopplung in der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung aus Sicht eines BHKW-Herstellers ausreichend Berücksichtigung?
Herr Grotholt, findet die Kraft-Wärme-Kopplung in der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung aus Sicht eines BHKW-Herstellers ausreichend Berücksichtigung?Auch wenn die letzten Details der Ausschreibungen noch nicht bekannt sind, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass sich die dezentrale KWK dort nicht wiederfinden wird. Umso wichtiger wird es sein, bei der Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes die richtigen Weichen zu stellen, damit die Technologie ihre großen Stärken für den zukünftigen Energiemarkt optimal ausspielen kann.
…und die wären?
Die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung kommt weitgehend mit vorhandener Infrastruktur aus. Es bedarf keiner langen Planungs- und Genehmigungsverfahren und in komplementärer Zusammenarbeit mit Photovoltaikanlagen können gesamtsystemnützliche Standortversorgungen aufgebaut werden. Die KWK-Anlagen mutieren somit vom grauen Dauerläufer zum grünen Teamplayer. In Bestandsgebäuden ab 50 Wohneinheiten erzielt das Dreieck, bestehend aus Photovoltaik, Wärmepumpe und KWK-Anlage, bei den derzeitigen Rahmenbedingungen einen Return on Invest von weniger als sieben Jahren. Die im vergangenen Jahr zugebauten 14 Gigawatt (GW) an Photovoltaikleistung beeindrucken positiv. Analog dazu könnte auch unsere Branche jährlich bis zu sechs Gigawatt dezentrale Back-up-Kapazitäten aufbauen. Somit hätten wir bereits in nur vier Jahren von heute an die gemäß Bundesnetzagentur erforderliche Kapazität hinzugebaut – das ganze zudem hocheffizient und mit grünen Treibstoffen komplett klimaneutral.
Gibt es in der Kraftwerksstrategie Bereiche, in denen Sie mehr Engagement oder Unterstützung für notwendig halten?
Zum einen fehlt das politische Bekenntnis zur KWK und zum anderen zur Dezentralität insgesamt. Bis heute gibt es bei vielen politischen Entscheidungsträgern Zweifel an der Machbarkeit eines dezentralen Energiesystems – in besonderem Maße dann, wenn es um ein regeneratives Back-up geht. Es ist offensichtlich, dass die dezentrale Energieversorgung sowohl volks- wie auch betriebswirtschaftlich mit großen Vorteilen verbunden ist. Es liegt auf der Hand, dass die Transportverluste geringer ausfallen, der Netzausbau weniger stark vorzunehmen wäre und – wie schon beschrieben – sich Photovoltaik, Wärmepumpe und KWK ideal ergänzen. Vielleicht hängt man in politischen Kreisen noch dem Irrglauben nach, dass es sich bei diesen Konzepten um isolierte Eigenversorgungen handelt, wodurch das Gesamtsystem geschwächt würde. Hingegen sprechen wir heute von Standortversorgungen, die gesamtsystemdienlich eingesetzt werden. Ab 100 Kilowatt elektrische Nennleistung hat der KWK-Anlagenbetreiber mit Stromdirektvermarktern zusammenzuarbeiten. Diese senden externe Signale an die KWK-Anlagen, wenn im Netz der Allgemeinen Versorgung Spitzenbedarfe zu decken sind. Bleibt also festzuhalten: Die KWK-Anlagen werden heutzutage hochflexibel betrieben und sind prädestiniert für den Einsatz als Residualkraftwerk in immer dezentraler werdenden Versorgungsstrukturen.
„Es fehlt das politische Bekenntnis zur KWK.“
Welche Rolle kann die KWK in der Transformation unseres Energiesystems hin zu mehr Nachhaltigkeit und geringeren CO2-Emissionen spielen?
Eine große Rolle, denn zum einen wird der eingesetzte Treibstoff relativ vollständig genutzt, mit bis zu 90 Prozent Nutzungsgrad. Dadurch werden CO2-Emissionen vermieden, selbst wenn mangels Verfügbarkeit von regenerativen Gasen temporär noch Erdgas genutzt werden muss. Gemessen am derzeitigen Kraftwerksmix sparen wir pro erzeugter Kilowattstunde 120 Milligramm CO2 ein. Überdies sind unsere KWK-Anlagen bereits Hydrogen Proven. Sobald also grüner Wasserstoff an die neuralgischen Punkte transportiert wird, können wir Strom und Wärme CO2-neutral überlassen.
Der Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff für Blockheizkraftwerke wird oft als zukunftsweisende Lösung diskutiert. Ist das so?
Wenn wir die Möglichkeit des Betriebs von KWK-Anlagen mit Wasserstoff nicht entwickelt hätten, dann fehlte uns die Zukunftsfähigkeit. Es wird immer mehr Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft klar, dass zu einer erfolgreichen Energiewende nicht nur die grünen Elektronen beitragen, sondern ebenso die grünen Moleküle eine zentrale Säule des zukünftigen Energiemixes sein werden. Wir verstehen unter Sektorkopplung die Einbeziehung der vorhandenen Infrastruktur, die Einbeziehung des Gasnetzes und der damit verbundenden Speichervolumina. Alles andere wäre volkswirtschaftlicher Frevel.
Welche wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wären aus Ihrer Sicht erforderlich, um die Rolle der KWK im deutschen Energiesystem zu stärken und weiter auszubauen?
Zusätzlich zum grundsätzlichen politischen Bekenntnis zur KWK-Technologie und das bereits erwähnte Zusammenspiel mit Photovoltaik und Wärmepumpe gilt es, Klarheit in Sachen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz zu schaffen. Sicherlich bestehen bei der Überarbeitung im Hinblick auf eine zunehmend stromgeführte Fahrweise große Potenziale für das Strommarktdesign als Ganzes. Schließlich gilt es, Leistungsvorhaltung durch KWK-Anlagen zu vergüten. Um es mal ganz einfach auszudrücken: Jedes Stadtwerk, Krankenhaus oder jeder Industriebetrieb, der in eine dezentrale, stromgeführte und Regel- und Ausgleichsenergie vorhaltende KWK-Anlage investiert, schafft einen volkswirtschaftlichen Mehrwert durch den sinkenden Bedarf an neu zu errichtenden, großen Gaskraftwerken. Diesen Mehrwert muss das zukünftige KWKG entsprechend würdigen.
Könnten Sie ein oder zwei Beispiele für besonders erfolgreiche KWK-Projekte nennen, die von 2G Energy realisiert wurden, und erläutern, was diese Projekte auszeichnet?
In jüngster Vergangenheit sind viele Projekte aus dem Bereich innovative Kraft-Wärme-Kopplung hinzugekommen, die das äußerst effiziente Zusammenspiel aus KWK und Wärmepumpe exzellent demonstrieren. Als Beispiel sei hier das Projekt Glood in Papenburg erwähnt mit einer elektrischen BHKW-Leistung von insgesamt zehn Megawatt (MW) und einer thermischen Wärmepumpenleistung von 2,8 MW, das unter anderem an das Nahwärmenetz einer Gärtnerei eingebunden ist. Auch in Sachen Wasserstoff-BHKW verzeichnen wir eine steigende Nachfrage. Nennenswert ist hier aktuell der erste Umbau eines bestehenden 250-Kilowatt-Erdgas-BHKW auf den Betrieb mit reinem Wasserstoff im bayerischen Amberg, der in nur wenigen Tagen vollzogen wurde. Das Projekt dient sicherlich als Blaupause für viele weitere BHKW-Standorte auf der ganzen Welt.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die ideale Rolle der KWK in einem vollständig nachhaltigen Energiesystem aus?
Die KWK ist effiziente Rückgrattechnologie, die die Residuallast genau dann hochdynamisch liefert, wenn Sonne und Wind nicht verfügbar sind. Zukunftssicher wird diese Kraftwerkstechnologie durch die Treibstoffdiversität, schließlich können Biogas, regenerative Pyrolysegase wie auch Wasserstoff als Energieträger und somit auch Energiespeichermedien genutzt werden, aus denen nach Bedarf Elektrizität und Wärme bereitgestellt wird. Die KWK darf nicht isoliert gesehen werden, sondern bildet mit den weiteren Instrumenten im Gesamtkonzert eine Lösung, die das Zieldreieck der Umsetzung der Energiewende erst ermöglicht, nämlich die Energieversorgung sicher, umweltfreundlich und kostengünstig zu realisieren.
Interview: Alexander Schaeff
Im Interview, Christian Grotholt
Im Jahr 1995 gründete Christian Grotholt mit seinem Partner Ludger Gausling die 2G Energietechnik GmbH mit Sitz in Heek. Seit dem Börsengang im Juli 2007 ist er CEO der 2G Energy AG und verantwortet die Bereiche Strategie, Vertrieb und Digitalisierung.
Im Jahr 1995 gründete Christian Grotholt mit seinem Partner Ludger Gausling die 2G Energietechnik GmbH mit Sitz in Heek. Seit dem Börsengang im Juli 2007 ist er CEO der 2G Energy AG und verantwortet die Bereiche Strategie, Vertrieb und Digitalisierung.
https://2-g.com/de
Dieser Beitrag ist im Schwerpunkt Kraft-Wärme-Kopplung der Ausgabe Mai/Juni 2024 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Kraft-Wärme-Kopplung, 2G Energy, BHKW
Bildquelle: 2G Energy AG
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung
KWK: Wichtige Säule im Klimaschutz
[25.6.2024] Die Branche diskutierte auf dem 22. Duisburger KWK-Symposium Potenziale und Herausforderungen. mehr...
[25.6.2024] Die Branche diskutierte auf dem 22. Duisburger KWK-Symposium Potenziale und Herausforderungen. mehr...
Kraft-Wärme-Kopplung: Wird die Renaissance eingeläutet?
Bericht
[18.6.2024] Gemäß einer Entscheidung des EuG stellt das im Jahr 2020 novellierte KWK-Gesetz als umlagebasiertes Förderinstrument keine Beihilfe dar. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, eröffnet das der Kraft-Wärme-Kopplung neue Perspektiven. Auch einige Bremsklötze ließen sich beseitigen. mehr...
[18.6.2024] Gemäß einer Entscheidung des EuG stellt das im Jahr 2020 novellierte KWK-Gesetz als umlagebasiertes Förderinstrument keine Beihilfe dar. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, eröffnet das der Kraft-Wärme-Kopplung neue Perspektiven. Auch einige Bremsklötze ließen sich beseitigen. mehr...
Stadtwerke Gießen: Heizenergie aus der Lahn
Bericht
[27.5.2024] Die Stadtwerke Gießen (SWG) engagieren sich seit langem für die Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung. Ihr aktuelles Großprojekt, die innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage PowerLahn, nutzt das Wasser der Lahn als Wärmequelle. mehr...
[27.5.2024] Die Stadtwerke Gießen (SWG) engagieren sich seit langem für die Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung. Ihr aktuelles Großprojekt, die innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage PowerLahn, nutzt das Wasser der Lahn als Wärmequelle. mehr...
KWK-Symposium: Energiewende im Fokus
[21.5.2024] Am 19. Juni findet in Essen das 22. Duisburger KWK-Symposium statt, bei dem es um die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung im Klimaschutz und in der Energiewende geht. mehr...
[21.5.2024] Am 19. Juni findet in Essen das 22. Duisburger KWK-Symposium statt, bei dem es um die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung im Klimaschutz und in der Energiewende geht. mehr...
Serie KWK: Holzgas statt Erdgas
Bericht
[14.5.2024] Im letzten Teil der stadt+werk-Serie zur Kraft-Wärme-Kopplung geht es um Holzgas als Brennstoff für KWK-Anlagen. In Österreich sind Holzgaskraftwerke weit verbreitet, europaweit ist das technologische und wirtschaftliche Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. mehr...
[14.5.2024] Im letzten Teil der stadt+werk-Serie zur Kraft-Wärme-Kopplung geht es um Holzgas als Brennstoff für KWK-Anlagen. In Österreich sind Holzgaskraftwerke weit verbreitet, europaweit ist das technologische und wirtschaftliche Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. mehr...