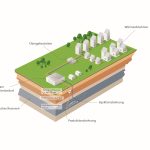GeothermieWichtiger Baustein

In der Geothermie steckt ein großes Potenzial, um Wärme umwelt- und klimafreundlich sowie verlässlich und preisstabil zur Verfügung zu stellen.
(Bildquelle: SWM/Steffen Leiprecht)
Lange Zeit fokussierte sich der öffentliche und politische Diskurs um den Ausbau erneuerbarer Energien nahezu ausschließlich auf erneuerbaren Strom. Obwohl über die Hälfte der Endenergie in Deutschland dazu genutzt wird, Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte zu heizen und um Wärme für Gewerbe und Industrie bereitzustellen, ist der klimafreundlichen Transformation des Wärmemarkts in der Vergangenheit wenig Beachtung geschenkt worden.
Spätestens mit der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und vor dem Hintergrund der kommunalen Wärmeplanung ist die Debatte darum, wie der Wärmemarkt der Zukunft aussehen kann, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der aktuelle Entwurf des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmnetze sieht Fristen für die Erstellung der Wärmepläne vor, die sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeindegebiete richten. Für jene mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gilt als Frist für die Abgabe eines Wärmeplans der 30. Juni 2026. Für jene mit weniger Einwohnenden räumt der Gesetzgeber Zeit bis zum 30. Juni 2028 ein. Zudem können kleinere Gemeinden (unter 10.000 Einwohnende) vereinfachte Verfahren mit reduzierten Anforderungen nutzen und sich auch in einem so genannten Konvoi-Verfahren zusammentun, um einen gemeinsamen Wärmeplan zu erstellen.
Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der Wärmeversorgung aus klimaneutralen Quellen zu decken. Dabei sieht das Wärmeplanungsgesetz erstmals auch rechtlich verbindliche Verpflichtungen für die Betreiber von Bestandswärmenetzen vor: Bis 2030 müssen erneuerbare Energien einen Anteil von 30 Prozent einnehmen. Bis 2040 müssen 80 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme bereitgestellt werden. Ab 2045 soll dann die gesamte Wärmeversorgung klimaneutral erfolgen. Dieser Transformationsprozess stellt viele Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Frage, wie Wärme nicht nur umwelt- und klimafreundlich, sondern auch verlässlich und preisstabil zur Verfügung gestellt werden kann, hat damit erheblich an Relevanz gewonnen. Geothermie kann ein Teil der Antwort auf diese Frage sein.
Effizienzmeister Erdwärme
Geothermie (Erdwärme) ist die unterhalb der Erdoberfläche gespeicherte Wärmeenergie. Je tiefer man in das Innere der Erde vordringt, desto wärmer wird es. In Mitteleuropa nimmt die Temperatur um etwa drei Grad Celsius pro 100 Meter Tiefe zu. Man geht davon aus, dass im Erdkern Temperaturen von etwa 5.000 bis 7.000 Grad Celsius erreicht werden. Diese in der Erde gespeicherte Wärme ist nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich. Aus dem Innern unseres Planeten steigt ein ständiger Strom von Energie an die Oberfläche. Die Erde strahlt täglich etwa viermal mehr Energie in den Weltraum ab, als wir Menschen derzeit verbrauchen. Rund 30 Prozent des an die Erdoberfläche steigenden Energiestroms kommen aus dem heißen Erdkern selbst. Weitere 70 Prozent entstehen durch den ständigen Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente in Erdmantel und Erdkruste. Die technische Nutzung dieser Energiequelle bezeichnet man als Geothermie.
Der Effizienzmeister Geothermie ist ein wichtiger Baustein für die Energie- und insbesondere für die Wärmewende. Sie ist nicht nur landschaftsschonend und klimafreundlich, sondern ermöglicht auch eine zuverlässige, preisstabile und sichere Energieversorgung. Geothermie ist immer verfügbar und wetterunabhängig. Mit den bereits entwickelten Technologien ist es fast überall möglich, das Potenzial der Erdwärme zu nutzen.
In Abhängigkeit von der Bohrtiefe wird zwischen Oberflächennaher und Tiefengeothermie unterschieden.
Oberflächennahe Geothermie
Die Oberflächennahe Geothermie nutzt den Untergrund bis zu einer Tiefe von circa 400 Metern und Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius für das Beheizen und Kühlen von Gebäuden, technischen Anlagen oder Infrastruktureinrichtungen. Hierzu wird die Wärme oder Kühlenergie aus den oberen Erd- und Gesteinsschichten oder aus dem Grundwasser gewonnen. Neben klassischen Anwendungsformen zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser wird die Oberflächennahe Geothermie auch zur Beheizung von Gewächshäusern sowie zur Enteisung von Weichen oder Parkplätzen eingesetzt.
In über 470.000 Ein- oder Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Schulen oder Gewerbebetrieben wird die Oberflächennahe Geothermie in Deutschland eingesetzt. Jährlich kommen knapp 31.000 Oberflächennahe Geothermieanlagen dazu (Stand 2022).
In Mittel- und Nordeuropa haben sich Erdwärmesonden als häufigste Anlagentypen durchgesetzt. Erdwärmesonden werden als senkrechte Bohrungen niedergebracht, in die Rohre eingelassen und durch eine Art Zement fest eingebaut. In Deutschland setzt man dafür zumeist Doppel-U-Rohre aus Polyethylen ein. Diese sind mit einer Wärmeträgerflüssigkeit, normalerweise Wasser mit einem speziellen Frostschutzmittel, gefüllt, welche die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an die Oberfläche zur Wärmepumpe transportiert. Hierzulande werden Erdwärmesonden normalerweise in 50 bis 160 Meter Tiefe eingebaut. Ein bis zwei Bohrungen reichen für die Beheizung eines Einfamilienhauses aus. Auch komplette Wohngebiete lassen sich auf diese Weise versorgen. Mit rund zwölf Zentimetern ist der Durchmesser des Bohrlochs vergleichbar mit einer CD und der Flächenverbrauch damit sehr gering.
Erdwärmekollektoren werden horizontal in 80 bis 160 Zentimeter Tiefe in Schlangenlinien verlegt. Ebenso wie in Erdwärmesonden fließt hier ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel. In diesen Tiefen haben die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen Auswirkungen auf die Untergrundtemperaturen. Die nutzbaren Temperaturen sind damit im Winter niedriger als bei Erdwärmesonden, reichen jedoch für den effizienten Wärmepumpenbetrieb aus. Die Kollektoren sollten in einen Untergrund verlegt werden, der Feuchte halten kann. Überbauungen sind zu vermeiden, da auch die Wärmezufuhr aus dem Regenwasser von den Kollektoren zur Wärmeversorgung herangezogen wird.
Tiefengeothermie
Die Tiefengeothermie nutzt Lagerstätten, die in größeren Tiefen als 400 Meter unter Geländeoberkante erschlossen werden. Die Reservoirtypen sind hier im Prinzip die gleichen wie bei der Oberflächennahen Geothermie. Zur kommerziellen Anwendung kommt in Deutschland derzeit nur die hydrothermale Tiefengeothermie. Unter hydrothermalen Lagerstätten versteht man Bereiche in Tiefen von mehr als 400 Metern, in denen Thermalwasser zirkuliert. Dieses kann in Karsthohlräumen, Klüften, Störungszonen oder Porengrundwasserleitern vorkommen.
Hydrothermale Lagerstätten sind in Deutschland in großer Zahl und in größeren Tiefen erschlossen. Voraussetzung für ein hydrothermales System ist das Vorhandensein einer ergiebigen wasserführenden Gesteinsschicht (Nutzhorizont), die eine möglichst weite vertikale und laterale Verbreitung aufweisen sollte, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Das in diesem natürlichen Reservoir zirkulierende Thermalwasser kann je nach Förderrate und Temperatur zur Erzeugung von Strom und Wärme oder lediglich Wärme genutzt werden. Meist wird das Thermalwasser mit zwei oder mehr Bohrungen genutzt. Eine so genannte Dublette besteht aus einer Förder- und einer Injektionsbohrung. Über die Förderbohrung wird das heiße Wasser aus dem Untergrund an die Oberfläche gefördert. Mittels eines Wärmetauschers wird dem Thermalwasser die thermische Energie entzogen und anschließend über die Injektionsbohrung in den Untergrund verbracht, wo es sich erneut erhitzt. Natürliche Reservoire mit ausreichender Wassermenge sind in Deutschland weit verbreitet. In den geothermischen Provinzen des Molassebeckens im Alpenvorland, dem Oberrheingraben und dem norddeutschen Becken sind hydrothermale Reservoire auch in ausreichender Tiefe vorhanden, um wirtschaftlich Strom zu erzeugen und Wärme zu nutzen.
Die Stadtwerke München (SWM) blicken hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit der Geothermie auf eine Geschichte von nahezu 20 Jahren zurück – die Anlage in Riem ging 2004 in Betrieb. Heute betreiben die SWM am Standort Süd die größte Geothermieanlage Deutschlands und arbeiten daran, die Fernwärmeversorgung der bayerischen Landeshauptstadt bis 2040 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen, größtenteils auf Grundlage der Geothermie.
Riesiges Potenzial
Das Beispiel München zeigt: Eine klimaneutrale Wärmeversorgung mit Erdwärme für Kommunen ist möglich, wenn man sich ernsthaft auf den Weg macht, die Potenziale zu heben. Und diese sind mannigfach: Oberflächennahe Geothermie kann standortunabhängig überall in Deutschland zum Einsatz kommen. Das Potenzial der Technologie für die Wärmeversorgung ist jüngst auf 600 Terawattstunden pro Jahr (TWh/a) beziffert worden (Roadmap Oberflächennahe Geothermie, 2022). Das entspricht bis zu 75 Prozent des kumulierten Nutzwärmebedarfs für Raumwärme und Warmwasser.
Konservative Schätzungen gehen im Bereich der Tiefengeothermie von einem Bereitstellungspotenzial von mindestens 118 TWh/a aus (Umweltbundesamt 2020). Eine neuere Studie, die Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und Helmholtz-Gemeinschaft durchgeführt haben, sieht das Potenzial der hydrothermalen Tiefengeothermie in Deutschland sogar bei bis zu 300 TWh/a (Roadmap Tiefe Geothermie, 2022).
Damit die großen Potenziale der Geothermie für die Wärmeversorgung der Zukunft nutzbar gemacht werden können, bedarf es einer Reihe von Maßnahmen, um den Ausbau der Technologie zu ermöglichen. Dazu gehört etwa die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren: Technisch wäre ein Projekt der Tiefengeothermie innerhalb von zwei bis drei Jahren umzusetzen. Durch komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren ist die tatsächliche Realisierungsdauer allerdings deutlich länger. Eine Standardisierung der Zulassungsanforderungen, die Parallelisierung von Einzelgenehmigungen und die Einführung verbindlicher Verfahrensfristen für Zulassungsverfahren würde die für Geothermievorhaben erforderlichen Genehmigungsprozesse deutlich vereinfachen und die Projektrealisierung erheblich beschleunigen.
Um das große geothermische Potenzial, das in Deutschland vorhanden ist, zu nutzen, sind zudem Menschen nötig, die es heben. Ob Brunnenbauer, Tiefbauer oder Geowissenschaftler – der Bedarf an erfahrenem Personal ist schon jetzt riesig und wird weiter zunehmen. Damit die klimafreundliche Energieversorgung unserer Gesellschaft langfristig gewährleistet werden kann, ist die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl an Fachkräften und somit die Verstärkung von Aus- und Weiterbildung zwingende Voraussetzung.
Fündigkeitsrisiko absichern
Eine weitere Maßnahme, um den Ausbau der Geothermie voranzutreiben, betrifft die Absicherung der Fündigkeit. Denn Tiefengeothermische Projekte sind zwar im Betrieb günstig, in der Anfangsphase jedoch mit hohen Investitionskosten verbunden. Positive operative Ergebnisse werden erst zeitversetzt erzielt. Um die finanziellen Risiken für Projektentwickler zu reduzieren und Investitionen anzureizen, bedarf es der Einführung eines Instruments zur Risikoabfederung.
Darüber hinaus sind für die erfolgreiche Umsetzung geothermischer Projekte genaue Kenntnisse des Untergrunds von herausragender Bedeutung. An vielen Orten in Deutschland sind diese aber ungenügend. Eine Explorationskampagne zur systematischen Erkundung des Untergrunds, um neue Geodaten zu gewinnen, kann – in Verbindung mit der Bereitstellung von Bestandsdaten – die Dynamik beim Ausbau der Geothermie erheblich verbessern.
Damit die Wärmewende gelingen kann, ist vor allem in urbanen Räumen die Dekarbonisierung der Fernwärme und der Ausbau der Wärmenetze notwendig. Um hier entsprechende Investitionen anzureizen, muss das Fördervolumen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) aufgestockt werden. In der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sollten die hocheffizienten Wärmepumpen in Kombination mit Oberflächennaher Geothermie zudem stärker als bisher berücksichtigt werden.
Maßgeschneidertes Gesetz nötig
Als schlafender Riese wird die Geothermie zukünftig eine Schlüsselrolle im erneuerbaren Wärmemix einnehmen. Bei der Fortschreibung des 7. Energieforschungsprogramms muss die geothermiebezogene Forschung deshalb angemessen mit Mitteln ausgestattet werden.
Die genannten Punkte sollten in einem Geothermie-Erschließungsgesetz gebündelt werden. Als maßgeschneidertes Mantelgesetz, ähnlich dem Wind-an-Land-Gesetz für den Windkraftausbau, sollte ein Geothermie-Erschließungsgesetz alle für ein Geothermievorhaben relevanten Regelungen im Sinne der Wärmewende anpassen. Nur so kann sich Deutschland auf den Weg in eine klimaneutrale Wärmeversorgung machen.
Dieser Beitrag ist im Schwerpunkt Geothermie der Ausgabe Januar/Februar 2024 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Hannover: Seismik-Messungen abgeschlossen
[14.04.2025] In Hannover ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärmeversorgung geschafft: Die Seismik-Kampagne für ein neuartiges Geothermieprojekt ist beendet. Im Sommer sollen die Bohrungen starten. mehr...
Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende
[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...
Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein
[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...
Berlin: Bohrungen am Südkreuz
[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...
Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet
[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...
Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie
[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...
Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen
[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...
Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie
[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...
Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik
[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...
Waren: Wartung des Bohrlochs
[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...
Geothermie: Multitalent für die Wärmeversorgung
[11.02.2025] Tiefengeothermie gilt als Rückgrat der Wärmewende und ist für die Bestückung neuer Netze mit Wärme und die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen alternativlos. Um sie wirtschaftlich nutzen zu können, müssen sich allerdings zahlreiche politische Rahmenbedingungen ändern. mehr...
Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt
[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...
GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie
[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...
badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt
[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...
München: Allianz für den Klimaschutz
[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...