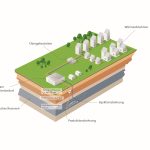GeothermieReise in die Unterwelt

Ende 2021 führten Vibrotrucks seismische Untersuchungen in der Domstadt Münster durch.
(Bildquelle: Stadtwerke Münster)
Das Fernwärmenetz der Stadtwerke Münster liefert jährlich rund 560 Gigawattstunden Wärmeenergie an knapp 6.000 private und gewerbliche Kunden. Wie sie künftig aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden kann, beschreibt eine im Jahr 2020 entwickelte Strategie zur Transformation der leitungsgebundenen Wärme in Münster.
Alle technologischen Entscheidungen für die grüne Wärmeerzeugung in Münster fußen auf einer umfassenden Analyse des Wärmemarkts der nordrhein-westfälischen Kommune und seiner perspektivischen Entwicklung bis zum Jahr 2050. Betrachtet wurden zukünftige Wärmebedarfe in Münster, angenommene Sanierungsquoten, Bevölkerungsentwicklung sowie Technologieentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Im angenommenen Szenario sinkt der Wärmebedarf in Münster von 3.200 Gigawattstunden im Jahr 2018 bis zum Jahr 2050 um 35 Prozent – trotz steigender Einwohnerzahl. Die Entwicklung der Energieträger verlagert sich weg vom Brennstoff Erdgas hin zu elektrischen Wärmepumpen und mehr Fernwärme – eine Entwicklung, die aktuell die hohen Gaspreise und der russische Krieg gegen die Ukraine zusätzlich beschleunigen. Der Anteil der Fernwärme am Energieträgermix wächst bei konstanter Erzeugung auf 30 Prozent.
Vielfältiger Technologiemix
Eine grüne Erzeugungstechnologie allein wird den zukünftigen Wärmebedarf in Münster nicht decken können, weshalb das Erzeugungszielkonzept einen vielfältigen erneuerbaren Technologiemix vorsieht. Die Leittechnologien Tiefe Geothermie und Solarthermie sollen einen Großteil des Bedarfs decken, ergänzt durch Umweltwärme-nutzende Wärmepumpen im industriellen Maßstab, Power-to-Heat-Anlagen und saisonale Großwärmespeicher. Von diesen Technologien eignet sich nur die Tiefe Geothermie für die Abdeckung der Grundlast, da sie witterungsunabhängig das ganze Jahr über stabil zur Verfügung steht und perspektivisch mehr als die Hälfte der benötigten grünen Wärme bereitstellen könnte. Allerdings ist ihre Realisierung mit den höchsten Investitionen, dem größten Zeitaufwand und den größten Risiken verbunden. Die technologische Vielfalt der Wärmestrategie hat daher den Vorteil, dass sie mehrere Projekte parallel verfolgt.
Da Tiefe Geothermie in Nordrhein-Westfalen noch wenig verbreitet ist und die Stadtwerke Münster nicht auf eigene Erfahrungswerte bauen konnten, sind sie im Januar 2021 eine Forschungspartnerschaft mit der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) eingegangen. Das Institut mit Sitz in Bochum bündelt das Know-how unterschiedlicher Fachdisziplinen, um Geothermieprojekte von der geologischen Grundlagenarbeit über Probebohrungen und Tests bis hin zur Planung von geothermischen Anlagen zu begleiten. Der starke Anwendungsbezug, das wissenschaftliche Renommee und die politische Vernetzung machen das Fraunhofer IEG zu einem wertvollen Partner.
Vorstoß in neue Genehmigungskontexte
Mit ihrem Engagement für die Tiefe Geothermie stoßen die Stadtwerke Münster in neue Genehmigungskontexte vor. Die Nutzung des Bodenschatzes Erdwärme, wie sie in Münster etwa aus Thermalwässern geplant ist, unterliegt in Deutschland dem Bergrecht. Mit der bergrechtlichen Aufsuchungserlaubnis sicherte sich der Versorger im Januar 2021 das exklusive Recht, die Ressource in Münster kommerziell zu nutzen.
Auch die Landesregierung Nordrhein-Westfalens sieht in der Geothermie eine große Chance für die Wärmewende. Ende des Jahres 2021 finanzierte sie eine 2D-Landesseismik-Kampagne in Münster und dem Münsterland. Die Untersuchung des Geologischen Dienstes NRW ist Teil einer integrierten geologischen Landesaufnahme, welche die geologischen Strukturen bis in Tiefen von mehr als 6.000 Metern charakterisieren und wasserführende Kalksteinformationen identifizieren soll.
Rund ein Jahr nachdem ein Konvoi von Vibrotrucks viele Bürger der Stadt Münster aus dem Schlaf rüttelte, liegen im Winter 2022 die ersten Erkenntnisse zur Geologie vor. Gleich drei übereinanderliegende Kalkgesteinsschichten konnten in 900 bis 1.700 Metern, 4.700 bis 6.300 Metern und 5.000 bis 6.700 Metern Tiefe detektiert werden. Je tiefer der Zielhorizont liegt, desto höher sind Temperatur im Untergrund und entnehmbare Leistung. Allerdings steigt auch der Planungs- und Investitionsaufwand für die Bohrung. Schon für eine Bohrung im niedrigen Zielhorizont von 2.000 Meter kalkulieren die Stadtwerke Münster mit Kosten von bis zu zehn Millionen Euro. So ist die für eine Bohrung notwendige Investition zunächst eine unternehmerische Wette darauf, im tiefen Untergrund auf geeignete Gegebenheiten zu stoßen.
Fündigkeitsrisiko als Hürde
Das Fündigkeitsrisiko ist eine der großen Hürden für Versorgungsunternehmen. Durch umfangreiche geologische Voruntersuchungen lässt sich die Gefahr einer erfolglosen Tiefenbohrung zwar verringern, jedoch nicht gänzlich bannen. Um eine größere Investitionssicherheit zu erreichen, wirbt die von den Stadtwerken Münster initiierte Kommunale Allianz für Geothermie NRW für die Idee eines Ausfallfonds, der bei Misserfolg einen Großteil der Kosten übernimmt.
Parallel laufen weitere geologische Analysen, denn jeder neue Datenpunkt verbessert die Erfolgschancen für nachfolgende Explorationsbohrungen und anschließende Fördertests. Anhand der 2D-Seismik lassen sich zwar grundsätzlich geeignete Gesteinsschichten mit Thermalwasservorkommen identifizieren, jedoch sind einige Fragen noch offen: Wo liegen vielversprechende Standorte für einen potenziellen Bohrstandort und ein künftiges Heizwerk? Ist das Thermalwasserangebot im Untergrund insgesamt ausreichend? Weist es ein passendes Temperaturniveau auf? Zur Beantwortung dieser Fragen planen die Stadtwerke Münster, das zweidimensionale Abbild von 2021 bis Ende dieses Jahres um eine weitere 3D-seismische Untersuchung zu erweitern.
Eine erste Probe- oder Förderbohrung wird frühestens im Jahr 2024 möglich sein. Im Folgejahr könnte anhand von Pumptests die Fündigkeit bewertet werden. Verlaufen die Tests positiv, folgen eine zweite Bohrung – die so genannte Injektionsbohrung – und Zirkulationstests. Sind diese ebenfalls erfolgreich, kann mit der Detailplanung der ersten Pilotanlage begonnen werden. Unter Berücksichtigung der Bauzeit gehen die Stadtwerke Münster heute davon aus, dass frühestens im Jahr 2030 eine Geothermieanlage grüne Wärme in das Fernwärmenetz einspeisen kann. Tiefe Geothermie bietet enorme Chancen für klimaneutrale Wärme in Münster, aber sie erfordert Geduld, einen langen Atem und viel Risikobereitschaft.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März/April 2023 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Hannover: Seismik-Messungen abgeschlossen
[14.04.2025] In Hannover ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärmeversorgung geschafft: Die Seismik-Kampagne für ein neuartiges Geothermieprojekt ist beendet. Im Sommer sollen die Bohrungen starten. mehr...
Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende
[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...
Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein
[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...
Berlin: Bohrungen am Südkreuz
[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...
Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet
[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...
Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie
[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...
Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen
[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...
Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie
[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...
Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik
[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...
Waren: Wartung des Bohrlochs
[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...
Geothermie: Multitalent für die Wärmeversorgung
[11.02.2025] Tiefengeothermie gilt als Rückgrat der Wärmewende und ist für die Bestückung neuer Netze mit Wärme und die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen alternativlos. Um sie wirtschaftlich nutzen zu können, müssen sich allerdings zahlreiche politische Rahmenbedingungen ändern. mehr...
Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt
[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...
GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie
[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...
badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt
[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...
München: Allianz für den Klimaschutz
[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...