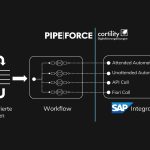Blockchain(R-)Evolution der Energiewirtschaft
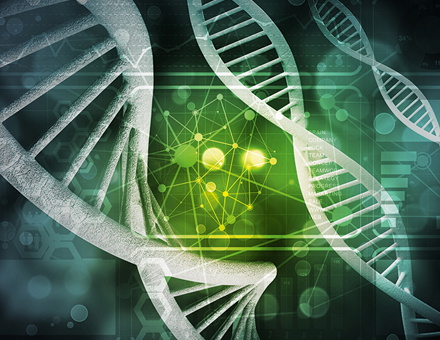
Die Blockchain-Technologie macht die generelle Datenverwendung im Internet kontrollierbar.
(Bildquelle: adam121/Fotolia.com)
Die Blockchain-Technologie hat es innerhalb von weniger als zwei Jahren geschafft, im gleichen Atemzug mit Digitalisierung, Big Data und Künstlicher Intelligenz genannt zu werden. Immer mehr Stimmen werden laut, die die Blockchain-Technologie generell als einen wesentlichen Beitrag zur nächsten Evolutionsstufe des Internet und für die Entwicklung hin zur Echtzeit-Energiewirtschaft mit Millionen und Milliarden von Geräten begreifen. Es besteht jedoch eine erhebliche Lücke zwischen den Potenzialen und Erwartungen auf der einen und dem Reifegrad der Technologie, konkreten Erfahrungen zur technischen Machbarkeit sowie wirtschaftlichen Mehrwerten auf der anderen Seite. Die Blockchain-Technologie steht technisch und wirtschaftlich immer noch am Anfang und die bislang in der Energie-Industrie identifizierten Anwendungen sind mehrheitlich Proof of Concepts, die noch entsprechend weit von einem kommerziellen Einsatz entfernt sind. Die Frage ist also berechtigt, was diese IT-Innovation so besonders macht.
Eine Blockchain ermöglicht die Kontrolle über Daten. Sie speichert Vorgänge wie den Austausch von digitalen Rechten (Einheiten einer Kryptowährung, Dokumente, Bilddateien) oder von Rechten an physikalischen Gütern unveränderlich in einer verteilten Datenbank. Diese befindet sich auf allen am Netzwerk teilnehmenden Rechnern. Hierfür wird die Historie aller Vorgänge, also der Geschäftsvorfälle und Transaktionen, in gewissen Zeitabständen zu Blöcken zusammengefasst und zwischen allen Teilnehmern synchronisiert.
Prozesse optimieren
Das Internet ermöglichte erstmals den weltweiten Austausch von Daten zu geringsten Kosten. Die Blockchain-Technologie verspricht hierfür einen entscheidenden Mehrwert, indem sie nicht nur das Teilen von Daten, sondern die generelle Datenverwendung im Internet kontrollierbar macht. Das erlaubt, den Fluss von Elektrizität in Netzen durch die exakte Erfassung der Ein- und Ausspeisung nachzuhalten. Elektrizität wird dann durch die Zuschreibung von Eigenschaften – wie Herkunft und Zeit – dinglicher, und somit zu einem differenzierbaren Produkt. Darüber hinaus verspricht die Blockchain-Technologie vollständiges Vertrauen in durchgängig digitalisierte Prozesse herzustellen. Die bisherige Notwendigkeit für vertrauenswürdige Intermediäre (Trusted Third Party) bei Transaktionen im Internet wird somit obsolet. Blockchain ermöglicht erstmals die direkte Abwicklung von digitalen Transaktionen inklusive Bezahlvorgang zwischen zwei unbekannten Akteuren ohne die Notwendigkeit einer Vermittlungsfunktion.
Durch den Wegfall von Intermediären können viele Prozesse, beispielsweise der Stromanbieterwechsel oder die Koordination von Regelenergie, vereinfacht und möglicherweise kostengünstiger organisiert werden. Ebenso realisierbar ist eine automatisierte Abfuhr von Abgaben, Umlagen, Entgelten oder Vergütungen. Für alle beteiligten Akteure können aufwendige Dokumentationsprozesse entfallen oder reduziert werden. Derzeit arbeitet eine Vielzahl von Start-ups und Energieversorgern an der Erprobung von Blockchain-Lösungen. Im Vordergrund steht derzeit meist die Optimierung energiewirtschaftlicher Prozesse wie Abrechnungen, Zertifizierung, die Verwaltung von Stammdaten oder Wechselprozesse. Während einige dieser Anwendungsfälle regulatorischer Änderungen bedürfen, um ihr volles Potenzial zu entfalten, ist beispielsweise ein Stromgroßhandel über die Blockchain bereits heute umsetzbar.
Energiewirtschaft in Echtzeit
Verteilte Energieerzeugungsanlagen und Lasten werden auch in den kommenden Jahren ihr Wachstum fortsetzen und zunehmend über das Internet steuerbar. Die Umkehrung der Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung hin zum Verbraucher schreitet somit weiter voran. Gleichzeitig steigt der ökonomische Druck, stetig verteilte Ressourcen für Netz und Markt lokal nutzbar zu machen. Ungenutzte Kapazitäten, nicht ausgelastete oder überdimensionierte Stromnetze und (Langfrist-) Speicher stellen erhebliche Opportunitätskosten dar. Die direkte Interaktion von Geräten verspricht, die Auslastung von Netzen sowie die Allokation von Flexibilitäten erheblich zu verbessern.
Basierend auf Signalen aus Netz und Markt stimmen in dieser Echtzeit-Energiewirtschaft eine Vielzahl von Geräten ihr Verhalten unentwegt aufeinander ab. Für eine Realisierung ist es allerdings notwendig, jede dieser Mikrotransaktionen sicher und effizient durchzuführen und nachvollziehbar zu machen. Die Blockchain-Technologie verspricht genau das: Kleinste Energieflüsse und Steuerungssignale können zu geringsten Transaktionskosten sicher nachgehalten und organisiert werden. Ein vielversprechendes Anwendungsbeispiel sind Abrechnungsprozesse des Strom- und Wärmeverbrauchs. Diese sind ohne Weiteres in der Blockchain abbildbar und können allen Beteiligten schnell und günstig zur Verfügung gestellt werden.
Die Datensouveränität der Verbraucher könnte sich hierbei als wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb herausstellen. Im Verbund mit intelligenten Messsystemen (iMsys) ergeben sich mögliche Vorteile bezüglich der Authentifizierung von Geräten wie Wärmepumpen, Kühlschränken oder Photovoltaikanlagen. Denn wird die eindeutige Kennung des Smart Meter Gateways mit einer Blockchain kombiniert – etwa mittels eines hardwareseitig implementierten Private Key –, dann können über diese Schnittstelle beliebig viele Geräte (Lasten und Erzeugungsanlagen) spontan authentifiziert werden. Auf diese Weise lassen sich Steuerungssignale zwischen Marktakteuren und Geräten austauschen und eine Photovoltaikanlage oder Batterie könnte nahtlos zwischen Eigenerzeugung, Regelenergiemarkt und Spotmarkt wechseln. Die Öffnung von intelligenten Messsystemen per BSI-Zertifizierung für Blockchains wäre daher ein wünschenswerter Vorgang.
Öffentliche Blockchain
Ein entscheidender Aspekt zur Kategorisierung von Blockchains ist die Ausgestaltung des Zugriffs. Prinzipiell wird hierbei zwischen öffentlichen (permissionless) und privaten (permissioned) Blockchains unterschieden. Als Hybridlösungen kommen in bestimmten Anwendungsfällen konsortiale (shared permissioned) Blockchains zum Einsatz. Die bekanntesten Blockchains, wie Ethereum oder die vornehmlich als Kryptowährung bekannte Bitcoin-Blockchain, sind öffentlich. Sie sind prinzipiell für jedermann zugänglich, eine passende Infrastruktur vorausgesetzt. Ein Teilnehmer wird in der Regel für alle anderen Teilnehmer über eine zufällige Adress-ID anonymisiert dargestellt. Es gibt in erster Instanz keinen zentralen Betreiber, der das laufende Geschehen in der Blockchain überwacht.
Öffentliche Blockchains beruhen bislang vor allem auf dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus zur Validierung neuer Datenblöcke. Dieser Prozess wird Mining genannt. Dabei konkurrieren alle am Netzwerk teilnehmenden Rechner um die Lösung eines algorithmischen Rätsels, wobei der Gewinner den nächsten Block generiert und dafür eine Belohnung in der zugrundeliegenden digitalen Währung erhält. Die Richtigkeit des gelösten Rätsels sowie die Integrität der gesamten Blockchain werden durch alle beteiligten Akteure verifiziert. Durch diesen ausgefeilten Konsensmechanismus ist Vertrauen zwischen einzelnen Marktteilnehmern bei einer Transaktion nicht mehr notwendig, da die Mehrheit aller Teilnehmer über die Korrektheit der Blockchain wacht.
Die Zuverlässigkeit einer öffentlichen Blockchain entscheidet sich somit durch eine ausreichend große Teilnehmerzahl, die die notwendige Rechenleistung und Speicherkapazität sicherstellt. Aktuell wird an ressourcenschonenderen Alternativen zu Proof of Work gearbeitet, beispielsweise den Proof of Stake. Sind diese Anstrengungen erfolgreich, dann können öffentliche Blockchains zwei wesentliche Vorteile gegenüber den Varianten private und konsortiale Blockchain ausspielen: Das ist zum einen die Teilnahme von Rechnern (wie Maschinen, Mobiltelefonen oder Tablets), die sich nicht kennen und nicht vertrauenswürdig sein müssen. Zum anderen entfällt die Notwendigkeit, dass das Konsortium neuen blockchainbasierten Anwendungen zunächst zustimmen muss. In den Zukunftsszenarien eines Internets der Dinge, einer Industrie-4.0-Welt oder einer Sharing Economy sind diese beiden Eigenschaften von fundamentaler Bedeutung.
Privat und konsortial
Bei privaten Blockchains ist der Zugang nur im Voraus ausgewählten Teilnehmern möglich. Diese haben je nach Zugriffsrecht die Möglichkeit, zu Lesen und/oder zu Schreiben. Die Blockchain unterliegt hier der vollkommenen Kontrolle des Betreibers, ihm sind alle Teilnehmer a priori bekannt. Aus diesem Grund entfallen im Gegensatz zu öffentlichen Blockchains in den meisten Fällen die Eigenschaften Anonymität und Irreversibilität. Abhängig vom gewählten Design kann es dem Betreiber prinzipiell möglich sein, getätigte Blockchain-Transaktionen zurückzusetzen. Bei Verzicht auf den Proof-of-Work-Konsensmechanismus und auf Unabänderlichkeit können Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Blockchain drastisch erhöht werden. Da nicht mehr alle Teilnehmer um die Lösung eines algorithmischen Puzzles konkurrieren müssen, ist die Validierung neuer Blöcke mit deutlich weniger Ressourcen möglich. Die hier genutzte Alternative ist der so genannte Proof of Authority, bei dem vorab bestimmte Teilnehmer neue Datenblöcke generieren.
Auf privaten Blockchains können sehr schnell und flexibel Anwendungen entwickelt und eingesetzt werden. Die erfolgversprechendsten Einsatzmöglichkeiten liegen vor allem bei unternehmensinternen Prozessen, ausgerichtet auf einen hohen Durchlauf an Daten. Die private Blockchain kann theoretisch in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel jährlich, abgetrennt und archiviert werden, was die Größe des Speichervolumens signifikant minimiert.
Konsortial-Blockchains oder auch semi-private Blockchains sind ein Kompromiss zwischen öffentlichen und privaten Blockchains. Hierbei ist es nur verifizierten Teilnehmern erlaubt, Blöcke zu validieren. Optimierte Konsensalgorithmen lassen hohe Transaktionsgeschwindigkeiten zu. Obwohl prinzipiell keine digitale Währung benötigt wird, um Transaktionen durchzuführen, können Tokens dennoch hilfreich zur Anreizsetzung sein. Insgesamt bieten Konsortial-Blockchains die Möglichkeit, auf die spezifischen Anforderungen des Energiemarkts abgestimmt zu werden, etwa durch den Verzicht auf Anonymität oder eine anwendungsabhängige Steigerung des Transaktionsvolumens. Aktuell arbeitet die Energy Web Foundation (EWF) als zukünftiger Betreiber einer Konsortial-Blockchain in der Energiewirtschaft an plattformübergreifenden Konzepten und Standardisierungsvorschlägen.
Die Interoperabilität unterschiedlicher Blockchains stellt eine weitere wichtige Eigenschaft dar. Ebenso wie der Anwendernutzen sozialer Netzwerke wie LinkedIn, Facebook oder WhatsApp von der Anzahl der Teilnehmer abhängt, ist der Wert einer Blockchain durch die Anzahl der Netzwerknutzer bestimmt: Je mehr Blockchains interagieren können, desto größer ist der potenzielle Nutzen für die Anwender. Zentrale Herausforderung ist, dass Assets auf einer Blockchain grundsätzlich nicht direkt auf eine andere Blockchain übertragen werden können, sondern ein Austausch bislang über einen Intermediär erfolgen muss.
Abwarten oder Ausprobieren?
Versorgern steht es frei, abzuwarten oder blockchainbasierte Anwendungen zu entwickeln und zu testen und so zur Entwicklung von Standards und des regulatorischen Rahmens entscheidend beizutragen. Die Geschichte des Internet zeigt aber deutlich, wie gefährlich eine Strategie des Zögerns wäre: Unter den großen Internet-Konzernen sucht man bekanntlich bis heute vergeblich europäische Unternehmen.
Der Verweis auf die nationale Natur der Energiewirtschaft ist aufgrund zahlreicher Wettbewerber aus der Tech- und IT-Branche wenig überzeugend. Ein Abwarten ist daher wenig ratsam und Formen des Ausprobierens reichen von der Mitarbeit in Verbänden über Kooperationen mit anderen Versorgern oder Start-ups bis hin zu Forschungsprojekten. Prinzipiell sollte das Ziel vorerst sein, relevante Abteilungen und Mitarbeiter an das Thema Blockchain heranzuführen. Um die richtigen Fragen stellen zu können und erste Erfahrungen zu sammeln, sind keine Data Scientists oder Blockchain-Experten notwendig. Vielmehr sind Weiterbildungen wie der berufsbegleitende Masterstudiengang Digitales Energiemanagement der Hochschule Fresenius zweckmäßig. Teilnehmer lernen hier das Handwerkszeug, um datenbasierte Geschäftsmodelle zu verstehen und Lösungen mit Partnern zu entwickeln.
Stadtwerke Wörgl: Glasfaser digital dokumentiert
[17.04.2025] Die Stadtwerke Wörgl digitalisieren ihren Netzbetrieb mit VertiGIS ConnectMaster. Damit wird die Glasfaserdokumentation vollständig digital. mehr...
cortility: Kooperation mit Logabit
[08.04.2025] Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und modernen Workflow-Plattformen wollen die Unternehmen cortility und Logabit die Geschäftsprozesse von Versorgungsunternehmen weiter automatisieren. mehr...
energielenker: Kostengünstigste Energie nutzen
[27.03.2025] Auf der The Smarter E Europe in München stellt energielenker das Hausenergiemanagementsystem Enbas vor. Das System vernetzt Erzeuger und Verbraucher eines Gebäudes, um immer die günstigste Energie zu nutzen. mehr...
cortility: Kooperation mit Mako365
[25.03.2025] Eine strategische Zusammenarbeit haben die Firmen cortility und Mako365 vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Leistungen beider Unternehmen zu kombinieren und ihren Kunden ein erweitertes Service-Portfolio zu bieten. mehr...
Stadtwerke Rinteln: Auslagerung der IT-Infrastruktur
[24.03.2025] Die Stadtwerke Rinteln haben sich jetzt an dem Unternehmen items beteiligt und lagern ihre IT-Infrastruktur an das Unternehmen aus. mehr...
cortility: Kooperation mit datango
[11.03.2025] Mit einer neuen Partnerschaft wollen die Softwareunternehmen cortility und datango Lösungen anbieten, mit denen die Energiewirtschaft neue IT-Systeme effizienter nutzen kann. Insbesondere der Umstieg auf SAP S/4HANA soll erleichtert werden. mehr...
Hamburger Energienetze: Initiative für sichere KI-Nutzung
[05.03.2025] Künstliche Intelligenz wird für Unternehmen immer wichtiger, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Die Hamburger Energienetze arbeiten deshalb gemeinsam mit anderen großen Unternehmen in der Initiative Responsible AI Alliance an einem sicheren und fairen Einsatz der Technologie. mehr...
Wilken Software Group: Partnernetzwerk für GY
[20.02.2025] Mit der neuen Komplettlösung GY bietet die Wilken Software Group eine flexible und offene Plattform, die betriebswirtschaftliche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette automatisiert. Dabei setzt das Unternehmen auf die enge Zusammenarbeit mit etablierten Partnern. mehr...
cortility: Lösung für den MaLo-Ident-Prozess
[18.02.2025] Voraussetzung für den Lieferantenwechselprozesses LFW24 ist der MaLo-Ident-Prozess, der zwischen Netzbetreiber und Lieferant durchgeführt werden muss. Der SAP-Spezialist cortility bietet eine Lösung, die eine nahtlose Integration in das SAP IS-U-System ermöglicht. mehr...
Cloudlösungen: Schlüssel für die digitale Transformation
[13.02.2025] Im Zentrum der globalen Bemühungen um eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Energieversorgung steht die Energiewirtschaft. Die digitale Transformation ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Cloudtechnologien spielen dabei eine zentrale Rolle. mehr...
Wilken: Mit GY in die Zukunft
[11.02.2025] Auf der Fachmesse E-world in Essen stellt Wilken seine neue Marke GY vor. Mit der IT-Lösung will das Unternehmen den großen Herausforderungen der Energiebranche begegnen und setzt dabei auf Cloud-Technologie, Skalierbarkeit und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern. mehr...
Stadtwerke Bonn: Datagroup übernimmt IT-Service-Desk
[06.02.2025] Die Stadtwerke Bonn haben sich für Datagroup als Partner für den IT-Service-Desk entschieden. Ziel der Zusammenarbeit ist die Optimierung der IT-Dienstleistungen sowie die Betreuung der Mitarbeitenden durch umfassenden Support. mehr...
LENA: Tool zur Unterstützung bei der Wärmeplanung
[05.02.2025] Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) hat ein neues Datentool entwickelt, das Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützen soll. Das Tool bündelt über 100 Datensätze und kann so die Erstellung von Wärmeplänen vereinfachen. mehr...
Stadtwerke Bad Windsheim: Entscheidung für IVU-Lösung
[04.02.2025] Die Stadtwerke Bad Windsheim setzen künftig auf IVU Informationssysteme für ihr ERP- und Abrechnungssystem. Die IVU konnte sich in einer europaweiten Ausschreibung mit einer umfassenden Lösung durchsetzen. mehr...
Stadtwerke Speyer: Marktkommunikation auf AS4 umgestellt
[03.02.2025] Die Stadtwerke Speyer haben ihre Marktkommunikation auf das AS4-Protokoll umgestellt. Dabei kam der anbieterunabhängige AS4 Cloud Service von procilon zum Einsatz. mehr...