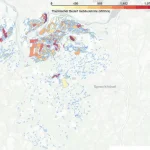Stadtwerke RostockNutzen statt abregeln
55 Meter hoch, 45 Millionen Liter Heißwasser: Der Wärmespeicher der Stadtwerke Rostock ist Grundlage für die Fernwärme-Vergrünung.
(Bildquelle: Stadtwerke Rostock AG)
Die Stadtwerke Rostock AG haben auf dem Weg zur klimaneutralen Energieversorgung mit dem Bau eines Wärmespeichers und einer Power-to-Heat-Anlage bereits erste Meilensteine gesetzt: Der drucklose Stahlbehälter speichert 45 Millionen Liter heißes Wasser bei einer Temperatur von 98 Grad Celsius und speist es bedarfsgerecht ins Wärmenetz ein. Mit seiner Kapazität von zwei Millionen Kilowattstunden kann er Rostock ein Wochenende lang mit Fernwärme versorgen. Direkt neben dem Speicher wurde eine Power-to-Heat-Anlage errichtet. Sie nutzt überschüssigen Strom aus Wind- und Solarenergie, um daraus Wärme zu erzeugen und den Speicher aufzuladen.
Gleichzeitig hilft die Anlage, das Stromnetz vor Überlastung zu schützen und eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Jahr für Jahr werden Windkraftanlagen bei hohem Windaufkommen abgeschaltet und die Betreiber für Verluste entschädigt, weil die Stromnetze Transport und Verteilung in die Lastzentren nicht bewältigen können, der Strom aus den erneuerbaren Energien aber auch nicht vor Ort verbraucht werden kann. Diesen grünen Überschuss-Strom aus Wind oder Sonne gilt es zu nutzen. Im Zusammenspiel mit dem Wärmespeicher wird diese grüne Energie in Rostock für die Wärmeversorgung verwendet. Nutzen statt abregeln – das ist ökologisch und ökonomisch.
Masterplan als Basis
Rostock hat früher als viele andere Großstädte einen kommunalen Wärmeplan erarbeitet und damit Zeit gewonnen. Basis dafür war der „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“, den die Rostocker Bürgerschaft bereits 2014 beschlossen hatte. Initiator des Wärmeplans war das Rostocker Umweltamt. Es beantragte 2017 Fördergelder für die Erstellung des Wärmeplans. Vom Start der Projektgruppe im Jahr 2020 bis zum Beschluss des Wärmeplans vergingen etwa zwei Jahre. In der Projektgruppe arbeiteten Vertreter unterschiedlichster Interessengruppen der Stadtgesellschaft zusammen, die von der Transformation der Wärmeversorgung betroffen sind oder sie selbst gestalten, wie die Wohnungswirtschaft, die Universität Rostock und Mitglieder des Agenda-21-Rates, verschiedene Ämter, Verbände, Politiker und Experten für unterschiedliche klimaneutrale Erzeugungstechnologien.
Die Stadtwerke Rostock sind maßgeblich an der Umsetzung des Wärmeplans beteiligt und haben den Prozess von Anfang an eng begleitet. Wichtig war und ist dabei die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bei gleichzeitiger Transparenz unterschiedlicher Interessenlagen. Auf mehreren Foren und Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung wurden auch die Rostockerinnen und Rostocker in die kommunale Wärmeplanung einbezogen.
Beste Erzeugerparks ermittelt
Unter Zuhilfenahme von Machbarkeitsstudien hat der Wärmeplan verschiedene Lösungen der klimaneutralen Wärmeversorgung analysiert. Ziel der Fachgutachten und Untersuchungen war es, das Optimum für bezahlbare, sichere und klimaneutrale Wärme zu ermitteln. Für unterschiedliche Szenarien sind im Wärmeplan verschiedene Erzeugerparks und Speichermöglichkeiten durchgerechnet worden. Die Universität Rostock hat dafür ein Energiemodell der Stadt entwickelt und verschiedene Erzeugerparks simuliert. Aus dutzenden Möglichkeiten wurden die vier besten Erzeugerparks hinsichtlich Klimafreundlichkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit ermittelt. Eine Erkenntnis aus der Netzentwicklungsplanung ist, dass klimaneutrale Fernwärme im verdichteten Stadtgebiet die wirtschaftlichste Option zur Ablösung dezentraler fossiler Wärme ist. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, hat der Wärmeplan außerdem so genannte No-Regret-Maßnahmen herausgearbeitet, die in jedem Fall ergriffen werden sollten. Für die Stadtwerke Rostock ergeben sich daraus umfangreiche Investitionen bei der Umsetzung der grünen Wärmeerzeugung. Auf der Erzeugerseite untersuchen die Stadtwerke im Moment die Umsetzung dieser No-Regret-Maßnahmen. Darunter sind Investitionsentscheidungen zu verstehen, die in jedem Szenario auf dem Weg zur Klimaneutralität ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind.
Weg mit vielen Zwischenzielen
Die Umsetzung der Rostocker Wärmewende ist ein Weg mit vielen Zwischenzielen: Nach der Fertigstellung des Wärmespeichers 2022 und der Inbetriebnahme der Power-to-Heat-Anlage 2023 prüfen die Stadtwerke derzeit, welche alternativen Wärmequellen für die Dekarbonisierung der Wärme und die Umsetzung des Wärmeplans genutzt werden können. Eine potenzielle Wärmequelle ist dabei eine Abwasserwärmepumpe. Sie nutzt die Restwärme des geklärten Abwassers am zentralen Klärwerk der Stadt mithilfe einer Großwärmepumpe. Eine weitere Möglichkeit könnte eine Großwärmepumpe sein, die Wärmeenergie aus dem Fluss Warnow gewinnt, der durch Rostock fließt. Auch Abwärme aus industriellen Prozessen, wie zum Beispiel aus der Wasserstoffproduktion, kann perspektivisch genutzt werden. Im Rostocker Seehafen befinden sich im Moment mehrere Wasserstoffprojekte in Planung oder Untersuchung.
Im Sommer wird weniger Wärme als im Winter benötigt – die saisonal unterschiedlichen Energieverbräuche müssen daher mit der ganzjährigen Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen und Abwärmepotenzialen in Einklang gebracht werden. Die Lösung können zusätzliche große saisonale Wärmespeicher sein, die nicht nur Tagesspitzen oder Differenzen mehrerer Tage ausgleichen können. Innerhalb des europaweiten Treasure-Projekts sammelt Rostock Erfahrungen bei der Planung und dem Betrieb solcher Wärmespeicher und tauscht sie mit anderen Partnern aus. In der zweiten Jahreshälfte will die Hanse- und Universitätsstadt mit einer geförderten Machbarkeitsstudie selbst einen saisonalen Wärmespeicher untersuchen und dafür geeignete Flächen finden, die nicht für andere Zwecke nutzbar sind.
Pro Quartier nur eine Technologie
Im kommunalen Wärmeplan hat die Rostocker Klimaschutzleitstelle für alle Stadtgebiete die beste Technologie für deren Wärmeversorgung ermittelt. Dabei gilt für jedes Quartier: Es kann nur eine Technologie geben. Entweder wird dort die Fernwärme ausgebaut oder die Leistung des Stromnetzes für moderne Wärmepumpen. Der Fernwärmeausbau spielt dabei im urban-verdichteten Raum die zentrale Rolle. Ein über 400 Kilometer langes Netz aus Rohrleitungen schließt schon heute zwei Drittel aller Haushalte in Rostock an die Versorgung an. Bis 2035 soll die Anschlussquote auf bis zu 80 Prozent steigen.
Die damit verbundenen Baumaßnahmen stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Zum einen müssen sie mit anderen wichtigen Investitionen der Stadt in Einklang gebracht werden. Das betrifft unter anderem die Erneuerung der Wasser- und Abwassernetze, die Erweiterung des ÖPNV-Netzes, geplante Straßensanierungen sowie den Hochwasserschutz. All das bindet Geld, Planungskapazitäten, Baufirmen und Fachpersonal. Erforderlich sind daher schnelle und unbürokratische Genehmigungsverfahren, aber auch eine wirksame Priorisierung und Koordinierung der Baumaßnahmen. Eine Stadt und ihre Einwohner vertragen sicher nur eine begrenzte Anzahl parallel laufender Baustellen.
Langfristige Planungssicherheit vonnöten
Vereinfachte Antragstellungen und Nachweispflichten können ebenfalls helfen. Bei der Wärmeerzeugung und Speicherung geht es um Anlagen, die Jahrzehnte laufen sollen und müssen. Solche Investitionen benötigen langfristige Planungssicherheit. Und sie müssen sich rechnen, damit auch die grüne Energieversorgung für die Kundinnen und Kunden verlässlich und bezahlbar bleibt.
Ihre guten Ausgangsbedingungen für die grüne Wärmeversorgung verdanken ostdeutsche Großstädte wie Rostock übrigens einem Erbe der DDR: Bei der Erfüllung des staatlich gelenkten DDR-Wohnungsprogramms wurde auch der Ausbau von Fernwärmenetzen zur Versorgung der Großwohnsiedlungen schon früh vorangetrieben. „Die ökonomischen und ökologischen Vorteile der Fernwärme liegen in einem verdichteten Stadtgebiet auf der Hand. Bis zu 80 Prozent aller Haushalte sollen bis 2035 an das Rostocker Fernwärmenetz angeschlossen werden, das schrittweise auf regenerative Quellen umgestellt wird. Es wird aber auch weiterhin Quartiere mit Einzellösungen geben, die in der kommunalen Wärmeplanung genau ermittelt wurden. Der kommunale Wärmeplan schafft damit im Konsens aller Beteiligten Verbindlichkeit. Er hilft dabei, das Ziel der Klimaneutralität schnell und sozialverträglich – also auch zu bezahlbaren Preisen – zu erreichen“, resümiert Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli/August 2024 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Bürgerbeteiligungsreport: Wärmewende als Belastung
[22.04.2025] Die Wärmewende sorgt bei vielen Menschen für Unsicherheit. Das zeigt eine neue Studie des Steinbeis-Instituts. Viele Bürger fürchten hohe Kosten und mangelnde Beteiligung. mehr...
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...