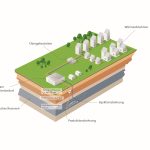GeothermieMultitalent für die Wärmeversorgung

Die Investitionskosten für Bohrungen und Anlagen sind bei der Geothermie hoch.
(Bildquelle: Heng Heng – AI Stock)
Die Klimakrise und die dringend notwendige Senkung unserer CO₂-Emissionen stellen hohe Anforderungen an die Energieversorgung. Der Gebäudesektor ist für 30 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Tiefengeothermie bietet hier vielversprechende Möglichkeiten, denn mit ihr lassen sich Gebäude klimaneutral heizen und kühlen. Zudem kann die Tiefengeothermie Strom erzeugen, Prozesswärme liefern oder auch Gewächshäuser heizen.
Allein im Raum München hat die Tiefengeothermie im Vergleich zur Heizung mit Luftwärmepumpen das Einsparpotenzial eines mittleren Atommeilers. Die Volkswirtschaft spart mit ihr täglich Millionen an Transfers, die für ausländische fossile Rohstoffe notwendig sind. Mit Tiefengeothermie lässt sich die Energiewende vorantreiben und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Allerdings sind mit ihrer Nutzung einige Herausforderungen verbunden, zu nennen sind hier etwa die hohen Investitionskosten, die zu Beginn anfallen, politische Hürden sowie Herausforderungen bei der Finanzierung.
Ein bedeutender Vorteil der Geothermie ist ihre ökologische Bilanz. Durch die Nutzung von Erdwärme lassen sich die CO₂-Emissionen im Vergleich zu fossilen Heiztechniken drastisch senken. Geothermieprojekte leisten einen unmittelbaren Beitrag zur Dekarbonisierung von Wärmenetzen und beschleunigen den Übergang hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Die tiefengeothermische Nutzung ist im Betrieb nahezu emissionsfrei und erfordert keine zusätzlichen Ressourcen wie Brennstoffe, was sie zu einer nachhaltigen und zuverlässigen Lösung macht.
Herkulesaufgabe Finanzierung
Die Finanzierung von Geothermieprojekten ist für Gemeinden, die Erdwärme nutzen wollen, allerdings eine Herkulesaufgabe. Denn die Investitionskosten für Bohrungen und Anlagen sind hoch, und die Fördermittel reichen bei Weitem nicht aus, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Staatliche Förderprogramme wie die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) bieten zwar Unterstützung, decken jedoch nur Teilbereiche ab. Zusätzlich sind für eine langfristige Planungssicherheit dringend verlässliche politische Rahmenbedingungen notwendig. Doch derzeit bestehen Unsicherheiten in der Förderung und den regulatorischen Anforderungen, die Investoren abschrecken und die Entwicklung geothermischer Projekte verlangsamen. Die im Kabinett bereits beschlossene Fündigkeitsversicherung zur Absicherung der Bohrrisiken durch KfW und Munich Re ist mangels verabschiedeten Bundeshaushalts erst einmal auf die lange Bank geschoben und harrt einer neuen Bundesregierung.
Nachteile ausgleichen
Generell ist die Tiefengeothermie nach wie vor benachteiligt. Vor allem beim Wärmepreis kommt es zu Verzerrungen. Das hat mehrere Gründe: Zum einen gilt die Fernwärme von Stadtwerken, die durch die Verbrennung von Müll und Stromerzeugung mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) – also durch das Verbrennen von Gas – entsteht, als klimafreundlich und wird seit 20 Jahren subventioniert. Aber auch KWK-Anlagen, die vorwiegend fossile Energie verbrennen, erhalten nach wie vor massive Förderung. Die BEW gleicht diesen Nachteil lediglich teilweise aus.
Zum anderen benachteiligt der aktuell zu niedrige CO₂-Preis grüne Wärme. Wenn der untere Preis für die Tonne CO₂ bei 125 Euro liegt, wird erneuerbare Wärme erst im Jahr 2035 nicht mehr von mit KWK erzeugter Wärme verdrängt. Liegt der Preis für die Tonne CO₂ schon vor 2030 bei 125 Euro, wird es bereits fünf Jahre früher einen regelrechten Run auf erneuerbare Wärme geben.
Der niedrige CO₂-Preis sorgt also dafür, dass der Ausbau von Geothermie bis 2035 nur schleppend vorangeht. Die Einführung eines speziellen Wärmeindexes für erneuerbare Energien könnte helfen, die Geothermie besser zu positionieren und die Abhängigkeit vom fossilen Energiemarkt zu verringern. So hält sich zum Beispiel das kommunale Geothermie-Unternehmen der Gemeinde Pullach im Isartal, die IEP Innovative Energie für Pullach, an den Pullach Erneuerbare Wärmepreisindex (PEWI), der keine Wärmeerzeuger enthält, die weniger als 65 Prozent ihrer Wärme aus erneuerbaren Energien beziehen.
Ein weiterer Stolperstein sind die hohen Durchleitungsgebühren für Fernwärme, die deutlich über den Gebühren für Strom- oder Gasleitungen liegen. In Bayern etwa sind diese Kosten, die zum Beispiel die bayerischen Staatsforsten verlangen, bis zu zwanzigmal höher, was die Rentabilität der Geothermieprojekte schmälert und die Investitionsbereitschaft senkt. Außerdem fehlt es an einem spezifischen Preisindex für Wärme aus erneuerbaren Energien, was die Preisgestaltung für Geothermie zusätzlich erschwert und die Vergleichbarkeit im Markt mindert.
Synergien heben
Die Skalierung und effiziente Umsetzung von Geothermieprojekten lässt sich mit gezielten Kooperationen und Synergieeffekten erreichen. Vor allem in solchen Kommunen, in denen mehrere Bohrungen und vernetzte Systeme möglich sind, lassen sich durch die Verteilung der Spitzenlasten kosteneffiziente Lösungen schaffen.
Skaleneffekte, etwa durch vier bis acht Bohrungen anstelle von Einzelprojekten mit nur einer Förder- und einer Reinjektionsbohrung (Bürgermeisterdublette), könnten die Kosten um bis zu 30 Prozent senken. Durch diese Netzwerke könnten sich die Produktionskosten deutlich reduzieren lassen, was die Wirtschaftlichkeit der Geothermie langfristig steigern würde. Interkommunale Verbundprojekte tragen langfristig ebenso zu mehr Wirtschaftlichkeit bei.
Die Finanzierung von Geothermieprojekten basiert auf einem Mix aus Eigen- und Fremdkapital. Eine aktive Beteiligung der Bevölkerung und die Einbindung von strategischen Investoren könnten zusätzliche Mittel generieren und die Akzeptanz der Projekte in der Bevölkerung steigern. Die Stadtwerke könnten durch Bürgerbeteiligungen und das Auflegen eines Wärmefonds auch private Investoren gewinnen. Zugleich gibt es Überlegungen für die Gründung eigenständiger Wärmetransportgesellschaften, was die Verbreitung von Fernwärme effizienter gestalten kann. Die Anpassung der Finanzierungsregeln könnte hier ebenfalls neue Spielräume eröffnen.
Zukünftige Perspektiven
Tiefengeothermie kann als Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige und klimaneutrale Wärmeversorgung fungieren. Um jedoch ihr volles Potenzial auszuschöpfen, braucht es finanzielle Anreize und die Abschaffung bürokratischer Hürden. Zudem sind Innovationen und Kooperationen gefragt, um die Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern. Wenn es gelingt, die politischen Rahmenbedingungen klar und stabil zu gestalten, kann die Geothermie zur tragenden Säule der Wärmewende werden. In einer Zukunft, in der die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen minimiert ist und erneuerbare Energien das Rückgrat der Wärmeversorgung bilden, wird die Tiefengeothermie einen unverzichtbaren Beitrag zur Klimaneutralität leisten.
Die Transformation der Wärmeversorgung mit Tiefengeothermie ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern ein gesellschaftliches Ziel. Mit politischen und wirtschaftlichen Anstrengungen, einem klaren Förderregime und dem Willen zur Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Investoren und der Bevölkerung kann die Tiefengeothermie den Übergang zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung gestalten. Die Technologie ist da – jetzt gilt es, sie in die Breite zu tragen und gemeinsam die Weichen für eine klimafreundliche Zukunft zu stellen.
Potsdam: Tiefengeothermie für Energiewende
[11.04.2025] Die Energie und Wasser Potsdam fordert bessere Rahmenbedingungen für den Umbau in Zeiten der Energiewende und erhält Unterstützung vom VKU. mehr...
Krefeld: Bohrungen erreichen Festgestein
[10.04.2025] In Krefeld hat die wissenschaftliche Bohrung des Geologischen Dienstes NRW das Festgestein erreicht. Nun fördern die Fachleute erstmals Bohrkerne aus der Tiefe – auf der Suche nach dem rund 340 Millionen Jahre alten Kohlenkalk. mehr...
Berlin: Bohrungen am Südkreuz
[26.03.2025] Am Südkreuz in Berlin entstehen bis 2026 neue Wohn- und Gewerbeflächen, deren Energieversorgung durch ein modernes Geothermiesystem gesichert wird. Dafür werden derzeit 285 Erdwärmesonden installiert, die Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar machen sollen. mehr...
Krefeld: Forschungsbohrung zu Geothermie gestartet
[25.03.2025] In Krefeld ist vergangene Woche eine Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes NRW gestartet, um das Potenzial der Tiefen Geothermie in der Region zu untersuchen. mehr...
Praxisforum Geothermie Bayern: Neue Entwicklungen der Geothermie
[25.03.2025] Das Praxisforum Geothermie Bayern findet vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Pullach bei München statt. Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen der Geothermie zu diskutieren. mehr...
Germering/Puchheim: Gemeinsames Geothermieprojekt beschlossen
[25.02.2025] Die Städte Germering und Puchheim haben beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) ein Geothermieprojekt zu realisieren. Ziel ist eine unabhängige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die frühestens 2033 in Betrieb gehen soll. mehr...
Fraunhofer IEG: Bau eines Reallabors für Geothermie
[19.02.2025] Mit einer neuen Forschungsinitiative will das Fraunhofer IEG das Potenzial der Tiefengeothermie in Nordrhein-Westfalen erschließen. Mit einer Förderung von 52 Millionen Euro entsteht in der Städteregion Aachen eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur, die erneuerbare Wärmequellen für Kommunen und Industrie nutzbar machen soll. mehr...
Stadtwerke Münster: Positives Fazit zur 3D-Seismik
[14.02.2025] Die Stadtwerke Münster haben jetzt die umfangreiche geologische Untersuchung des Untergrunds abgeschlossen. Die Messungen sollen die Basis für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung durch Tiefengeothermie schaffen. mehr...
Waren: Wartung des Bohrlochs
[13.02.2025] Die Stadtwerke Waren investieren knapp eine Million Euro in die Wartung eines Bohrlochs der Geothermieanlage am Papenberg. Die Arbeiten sind entscheidend für den weiteren Ausbau der geothermischen Wärmeversorgung in der Region. mehr...
Stadtwerke Erfurt: Genehmigung für 3D-Seismik-Messungen beantragt
[30.01.2025] Die Stadtwerke Erfurt haben jetzt beim Thüringer Bergamt die Genehmigungsunterlagen für eine 3D-Seismik-Messung im Raum Erfurt eingereicht. Die Untersuchung soll die Grundlage für die Nutzung von Tiefengeothermie zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Stadt schaffen. mehr...
GeoTHERM: Einblick in Potenzial der Geothermie
[15.01.2025] Die GeoTHERM 2025 bietet vom 20. bis 21. Februar in Offenburg eine Plattform für Fachleute, Studierende und Bürger, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Geothermie auszutauschen. mehr...
badenova: Zielgebiet für Geothermie eingegrenzt
[20.12.2024] Für die im Oberrheingraben geplante Geothermie-Nutzung hat badenovaWÄRMEPLUS jetzt Hartheim und angrenzende Gemeinden in den Fokus gerückt. Ab 2028 könnte das heiße Thermalwasser zur Versorgung von bis zu 20.000 Menschen mit grüner Fernwärme genutzt werden. mehr...
München: Allianz für den Klimaschutz
[18.11.2024] Die Landeshauptstadt München, acht Kommunen der NordAllianz und die Stadtwerke München wollen enger zusammenarbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Versorgungssicherheit zu verbessern. mehr...
Münster: Stadt wird durchgerüttelt
[24.10.2024] Die Stadtwerke Münster starten Anfang November eine groß angelegte geologische Erkundung, um das Potenzial der Tiefengeothermie auszuloten. Diese könnte in Zukunft einen großen Teil des Wärmebedarfs in Münster klimaneutral decken. mehr...