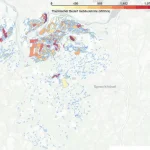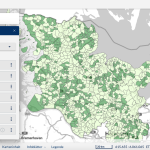WärmeversorgungLeckagen erkennen, Effizienz steigern

Die Datenübertragung vom LPN CM-4 Sensor von comtac funktioniert auch unter einer massiven, metallverstärkten Abdeckplatte.
(Bildquelle: comtac AG)
Wärmenetze funktionieren grundlegend anders als Stromnetze. Durch die Trägheit des Systems können die Betreiber auf Lastveränderungen nicht kurzfristig mit einer Anpassung der Einspeisung reagieren. Stattdessen muss permanent genügend Wärmeenergie ins Netz eingespeist werden, um kurzfristige Verbrauchserhöhungen abpuffern zu können. Das Vorhalten einer Puffermenge an Wärmeenergie ist unter Effizienzgesichtspunkten natürlich nicht optimal, gewährleistet jedoch eine zuverlässige Versorgung. Gleichzeitig liegt eine Minimierung der Puffermenge im wirtschaftlichen Interesse der Netzbetreiber. Ein Einflussfaktor für die Größe des Puffers sind Wärmeverluste durch Leckagen – also Dampf- oder Wasseraustritte – im Leitungsnetz. Diese Leckagen kosten nicht nur Wärmeenergie und Heizwasser, sondern können auch beträchtliche Schäden an der eigenen Infrastruktur sowie an Fremdeigentum verursachen. Da bei Netzen mit Hunderten von Kilometern an Rohrleitungen und Tausenden von Schachtdeckeln Leckagen kaum gänzlich zu vermeiden sind, muss der Ansatzpunkt deren möglichst schnelle Erkennung, exakte Lokalisierung und Beseitigung sein.
Überwachung automatisieren
Konventionelle Methoden, wie die Kontrolle der Schachtdeckel mit Wärmebildkameras – Dampfaustritte in den Versorgungskanälen sorgen für eine Temperaturerhöhung – stoßen prinzipbedingt an Grenzen. Angesichts der genannten Dimensionen ist eine derartige Kontrolle auch mit erheblichem Personaleinsatz nur zeitlich grobmaschig möglich, etwa alle zwei Wochen. Die Folge: Lecks bleiben im Extremfall in diesem Zeitraum unentdeckt.
Die Verbesserungspotenziale durch eine automatisierte Leckageüberwachung sind also evident. Der Betreiber eines Fernwärmenetzes einer Schweizer Großstadt initiierte eine entsprechende Ausschreibung. Ihr Gegenstand: Sensoren zur Feuchte- und Temperaturmessung für die Schächte. Diese Sensoren sollten ihre Daten zudem an die Back-End-Systeme des Netzbetreibers übermitteln, wo die Messdaten zu einer netzweiten, automatisierten Leckageüberwachung integriert, ausgewertet und visualisiert werden.
Diese Anforderungen konnte das Unternehmen comtac am besten erfüllen – mit einem serienmäßigen Produkt, das sich zuvor im Condition Monitoring im industriellen Umfeld bewährt hatte: der Sensor-Funkeinheit mit der Typbezeichnung LPN CM-4. Sie misst und protokolliert Temperatur- und Feuchtewerte und überträgt die Daten mithilfe einer integrierten Sendeeinheit für Datennetze gemäß dem LoRa-Standard. Beim Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) handelt es sich um ein leitungsloses Low-Power-Übertragungsverfahren, das zwar nur vergleichsweise niedrige Bandbreiten ermöglicht, aber auf Energieeffizienz, hohe Reichweiten und die gute Durchdringung von Bauwerken ausgerichtet ist.
LoRa für Leckageüberwachung prädestiniert
Das prädestiniert LoRa – ähnlich wie eine Reihe anderer Low-Power-Netzwerke (LPN) – für Anwendungen zur Leckageüberwachung. Schließlich können die Sensoreinheiten mit dieser Technik unter Normalbedingungen eine zuverlässige Datenübertragung aus den Schächten heraus gewährleisten. Dabei führen sie alle zwei Stunden eine Messung durch und übermitteln die Messwerte viermal am Tag. In diesem Modus funktioniert der LPN CM-4 im Batteriebetrieb deutlich länger als fünf Jahre, sodass ein Batteriewechsel ohne zusätzlichen Aufwand im Rahmen planmäßiger Vorort-Inspektionen möglich ist.
In der Schweiz bietet sich zur Datenübermittlung das landesweit von der Swisscom betriebene LoRa-Funknetz an. In Deutschland existiert zwar aktuell kein öffentliches LoRa-Netz mit vergleichbarer Flächendeckung, das ändert aber an den Möglichkeiten der Leckageüberwachung in Fernwärmenetzen wenig. Denn zum einen können regionale Energieversorger oder Fernwärmenetzbetreiber LoRa-Netze mit überschaubarem Aufwand selbst errichten und wirtschaftlich betreiben, wozu comtac technische Hilfestellung leisten kann. Zum anderen kann das Unternehmen die Sensoreinheiten auch mit Funkmodulen für andere LPN-Standards wie NB-IoT, Mioty oder 450 MHz anbieten.
Leck beseitigt, Energieverlust gesunken
Der Nutzen, der sich aus einer LPN-basierten Leckageüberwachung ergibt, wird im Beispielnetz überdeutlich: Leckagen werden im Normalfall schon nach wenigen Stunden zuverlässig erkannt, während die arbeitsaufwendige manuelle Kontrolle der Schachtdeckel mit Wärmebildkameras entfallen kann. Werden die Lecks zügig beseitigt, sinken die Energieverluste, was wiederum die Gesamteffizienz des Fernwärmenetzes positiv beeinflusst.
Mit anderer, ebenso serienmäßig verfügbarer Hardware ließen sich die Möglichkeiten noch erweitern. Dazu bietet comtac für Überwachungs- und Steuerungsaufgaben an Infrastrukturnetzen aller Art den Cluey, einen flexibel konfigurierbaren Monitor und Controller. Ausgestattet mit den passenden Sensoren und einem Funkmodul für LoRa oder andere Low-Power-Netzwerke kann das Gerät nicht nur Überwachungsaufgaben erledigen, sondern auch selbst Aktionen auslösen. Das können Schaltimpulse oder Alarme sein, die im Rahmen einer reinen Leckageüberwachung verzichtbar sind, im Rahmen breiter angelegter Lösungen für Infrastrukturüberwachung bis hin zu vorausschauender Wartung (Predictive Maintenance) aber zusätzliche Funktionalitäten bieten.
So oder so ergeben Komponenten wie der LPN CM-4 und der Cluey für sich gesehen natürlich noch keine Lösung, dazu braucht es unter anderem ein (Software-)System zur Erfassung und Auswertung der gewonnenen und übertragenen Daten. Da comtac über breit gefächerte Erfahrungen rund um die Themen Condition Monitoring und Informationsaufbereitung verfügt, kann das Unternehmen Netzbetreibern auch im Hinblick auf die Gesamtlösung beratend zur Seite stehen.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Mai/Juni 2022 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...
Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start
[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...