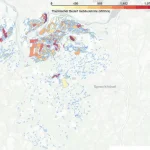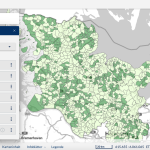ForschungKempen wird zum Reallabor

Die im Bau befindliche Wärmezentrale für das Baugebiet „Auf dem Zanger“ in Kempen, kurz bevor der 50 Kubikmeter fassende Wärmespeicher durch das Dach ins Innere gehoben wurde.
(Bildquelle: Stadtwerke Kempen)
Die Wärmeversorgung der Zukunft wird sich ebenso wie die Stromversorgung durch einen steigenden Anteil regenerativer Energien auszeichnen. Aufgrund der Fluktuation erneuerbarer Energien wegen wechselnder Wetterverhältnisse ist eine hohe Flexibilität gefragt. Diese wird im Forschungsprojekt BestHeatNet erprobt, welches das Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) an der Hochschule Düsseldorf (HSD) gemeinsam mit den Stadtwerken Kempen gestartet hat. Die Wärmeversorgung für das bereits im Bau befindliche Quartier „Auf dem Zanger“ in der nordrhein-westfälischen Stadt Kempen mit rund 130 Wohneinheiten wird hierfür für fünf Jahre zum Reallabor.
Multivariantes System
Solarthermie, Power to Heat durch eine Elektrowärmepumpe mit Erdsonde und Elektroheizstab, eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK), ein Spitzenlastkessel sowie eine Photovoltaikanlage mit Batterie produzieren zukünftig die benötigte Wärme und den Strom aus unterschiedlichen Energiequellen. Der Anteil an erneuerbaren Energien aus lokaler Produktion soll rund 30 Prozent betragen und ließe sich durch den Bezug von Biogas und Ökostrom weiter steigern.
Der Vorteil des multivarianten Systems aus den Power-to-Heat-Geräten (Erdwärmepumpe und Heizstab), dem zentralen Wärmespeicher und dem KWK-Modul liegt in der Kopplung des Strom- und Wärmemarkts und der damit verbundenen zusätzlichen Flexibilitätsoption für den Strommarkt (Strom verbrauchen oder produzieren). Ein Zusammenspiel dieser Wärmeerzeuger befähigt das Nahwärmesystem, neben Umweltschonung und Wirtschaftlichkeit auch die Netzdienlichkeit in eine umfassende Betriebsoptimierung einzubeziehen. Das aus Erzeugern mit unterschiedlichen Energiequellen – Sonne, Graustrom, Ökostrom, selbst produzierter Strom, Erdgas und Biogas – bestehende Nahwärmesystem kann flexibel auf sich verändernde energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Strommarktsituationen (hohe, niedrige, negative Strompreise), Netzbedingungen (hohe, niedrige Auslastung des Stromnetzes) und andere Faktoren (Sonneneinstrahlung, Außentemperaturen, Wärmebedarf der Kunden) reagieren.
Selbstlernende Steuerung
Neben einer direkten Einspeisung der Wärmeerzeuger in das Nahwärmenetz besteht auch die Möglichkeit eines multivarianten Energietransfers zwischen den Erzeugern. So hat die Wärmepumpe Zugriff auf den Solarwärmespeicher als Wärmequelle (Steigerung der solaren Gewinne), und es ist eine direkte Nutzung des in der KWK- oder Photovoltaikanlage produzierten Stroms zum Antrieb der Wärmepumpe oder des Heizstabs möglich.
Ein entsprechend komplexes Wärmeversorgungssystem benötigt zur Hebung der maximalen Kostenminderungs-, CO2-Minderungs- und Netzdienlichkeitspotenziale ein geeignetes Regel- und Steuerungssystem. Dieses soll so ausgestaltet werden, dass mittels Messwerten aus der Anlage und Kurzzeitprognosewerten für externe Größen wie Wetter, Strom- und Gaspreis sowie Wärmelast jederzeit die kosten- und/oder energieeffizienteste Betriebsstrategie gefahren wird. Dafür wird das Nahwärmesystem mit entsprechender Mess- und Steuerungstechnik ausgestattet, wodurch es flexibel auf unterschiedliche Markt-, Netz- und Bedarfsanforderungen reagieren kann.
Da die Randbedingungen während der Lebensdauer des Systems kontinuierlichen Änderungen ausgesetzt sind, soll die Regelung selbstlernend sein und gleichzeitig über ein Überwachungs- und Priorisierungssystem für den Betreiber verfügen. Selbstlernende Algorithmen analysieren beispielsweise, zu welchen Zeiten typischerweise an den einzelnen Tagen der Woche Wärme benötigt wird. Das System erkennt die Gewohnheiten und hebt bei Bedarf zum Beispiel die Netztemperaturen rechtzeitig an. Es greift auf Wetterprognosen zu und kann dadurch die solare Wärmeproduktion stundengenau vorhersagen. Es ermöglicht somit auch genaue Vorhersagen des Gas- und Stromverbrauchs für kurz- und mittelfristige Zeiträume und befähigt so den Betreiber, erfolgreich am Day-Ahead- oder sogar Intraday-Handel teilzunehmen.
Neuronale Netze im Vorteil
Selbstlernende Systeme können besonders gut durch nicht-parametrische Metamodelle wie künstliche neuronale Netze abgebildet werden. Diese weisen bei der Auswertung einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den sonst eingesetzten detaillierten Systemsimulationen oder anderen Lösungsansätzen auf.
Die Schnelligkeit künstlicher neuronaler Netze begünstigt auch den Einsatz von sonst rechenintensiven Optimierungsalgorithmen (Partikelschwarmoptimierung, genetische Optimierer) zur Ermittlung der optimalen Regelungs- und Einsatzparameter in Form von Paretofronten, ohne vorherige Gewichtung der oft divergierenden Bewertungskriterien für Energieeffizienz, Kosten und Systemdienlichkeit. Diese Paretofronten beinhalten das ganze Spektrum vom energieeffizientesten bis hin zum wirtschaftlichsten Betrieb der Anlage. Der Betreiber kann fortlaufend entscheiden – je nach aktueller Priorisierung von Ökologie und Ökonomie.
Haus- und Wohnungsstationen anpassen
Zur weiteren Effizienzsteigerung des Wärmenetzes und zur Umsetzung eines Niedertemperaturnetzes mit möglichst geringen Vor- und Rücklauftemperaturen und somit Wärmeverlusten bedarf es verbraucherseitig angepasster Haus- oder Wohnungsstationen. Dabei gilt es, vor allem die Trinkwarmwasserbereitung und -zirkulation in den Blick zu nehmen, da bei gut wärmegeschützten Neubauten heizseitig witterungsabhängig nur geringe Temperaturen benötigt werden. Neben den klassischen gebäudeweisen Stationen mit Warmwasserzirkulation sollen deshalb in den Mehrfamilienhäusern wohnungsweise Stationen ohne Zirkulation, ohne Zirkulation und mit elektrischer Nachheizung sowie ein innovatives Konzept einer zentralen, gebäudeweisen Übergabestation mit Speicher und Warmwasserzirkulation untersucht und verglichen werden.
Das intelligente Nahwärmenetz „Auf dem Zanger“ dient als Blaupause für zukünftige Wärmenetze in Kempen. Aktuell finden die Erschließung des Baugebiets und der Bau der Heizzentrale statt. Die Planungen sehen einen Abschluss der Bauarbeiten an der Heizzentrale bis Ende dieses Jahres und erste Wärmelieferungen an Kunden Anfang/Mitte 2020 vor.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli/August von stadt+werk im Schwerpunkt Wärmeversorgung erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...
Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start
[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...