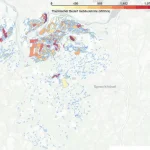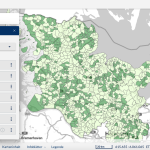HörstelKalte-Nahwärmenetz geplant

Begutachtung der Probebohrungen für das Kalte-Nawärmenetz in Hörstel.
v.l.: Klimaschutz-Manager Tobias Reuter; SWTE Netz-Ingenieur Christoph Mersch; Philipp Hänsel, Fachbereichsleiter Planen und Bauen: Christian Ungruh, Leiter Bürgerdienst
(Bildquelle: SWTE Netz GmbH & Co. KG)
In der nordrhein-westfälischen Stadt Hörstel soll ein Nahwärmenetz für das Uferquartier entstehen. Wie das Unternehmen SWTE Netz mitteilt, wertet es jetzt die hierfür vorgenommenen Probebohrungen aus. Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Teclenburger Land, die das Nahwärmenetz im Hörsteler Uferquartier bauen und betreiben wird, erstelle nun die Detailplanung. Die Wärmeversorgung im Neubaugebiet solle in Zukunft mithilfe eines so genannten Kalte-Nahwärme-Netzes erfolgen. Das Wärmenetz setzt als Energieträger Erdwärme ein, was sich günstig auf die Öko-Bilanz auswirke. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördere das Projekt. Wenn alles nach Plan verläuft, werde das Netz im kommenden Jahr gebaut. In wenigen Wochen beschäftigten sich die politischen Gremien in Hörstel mit dem Stand der Planungen.
Die für das Kalt-Nahwärmenetz benötigte Erdwärme werde über Erdsonden gesammelt. Anders als bei der geothermischen Wärmeversorgung einzelner Liegenschaften werde die Erdwärme über ein Sondenfeld innerhalb des Quartiers gefördert. Ideal sei eine Bohrtiefe von 150 Metern. Kann diese aufgrund geologischer Gegebenheiten nicht erreicht werden, werde das durch zusätzliche Sonden ausgeglichen. In Hörstel erlaubten die geologischen Verhältnisse Bohrungen lediglich bis zu einer Tiefe von maximal 80 Metern. Die aus der Tiefe gewonnene Erdwärme werde mittels eines Wassergemisches zu den einzelnen Abnahmestellen transportiert und in den jeweiligen Gebäuden mithilfe von Wärmepumpen auf die gewünschte Temperatur gebracht. Die Ökobilanz der Häuser im Quartier verbessere sich zusätzlich, wenn die Immobilien über PV-Anlagen mit Eigenstromnutzung verfügen. Kommt ausschließlich Öko-Strom zum Einsatz, arbeite die Wärmeversorgung nahezu CO2-neutral.
Für das Quartier in Hörstel sei eine Trassenlänge von knapp 900 Metern vorgesehen. Neben den Wohnhäusern solle das Wärmenetz in Zukunft den geplanten Rathaus-Neubau sowie das benachbarte Feuerwehrgerätehaus versorgen. Eine Ausweitung zur Unterstützung von Bestandsgebäuden werde im Zuge der weiteren Planung untersucht. Der Wärmebedarf sei mit rund 840 Megawattstunden (MWh) pro Jahr für das Uferquartier inklusive der städtischen Gebäude prognostiziert. Sollte das Baugebiet wachsen, könne auch das Wärmenetz modular erweitert werden. Gesteuert werde das Netz aus einer Technikzentrale heraus. Dadurch könne der Betreiber Störungen unmittelbar erkennen und beheben.
Im Gegensatz zur Wärmeversorgung auf der Grundlage herkömmlicher fossiler Energieträger biete das Kalte-Nahwärme-Netz viele Vorteile. Die Versorgungssicherheit sei sehr hoch. Der Energieträger Erdwärme stehe das ganze Jahr über zur Verfügung. Das Netz arbeite ohne nennenswerte Abstrahlungsverluste, weil das Wassergemisch mit recht kühlen Temperaturen von vier bis 20 Grad transportiert und erst in den Immobilien vor Ort auf die erforderliche Nutztemperatur gebracht wird. Dabei könne das Netz nicht nur für Wärme, sondern im Sommer auch für Kühlung sorgen. Aufgrund der CO2-Einsparung im Wärmenetz erreichten die Häuser die förderfähigen Standards der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...
Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start
[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...