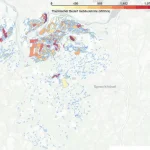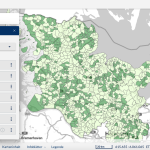WärmeversorgungGemeinsam zum grünen Wärmenetz

Wollen Kommunen grüne Wärmenetze errichten, muss neben der Frage der Finanzierung die richtige Struktur zur Projektumsetzung erarbeitet werden.
(Bildquelle: STEAG)
Die Errichtung und der Betrieb von öffentlichen Nah- und Fernwärmenetzen ermöglichen es Kommunen, eine effiziente und ortsnahe Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien sicherzustellen. Die Rolle der Kommunen als Eigentümer von leistungsfähiger Infrastruktur wird dabei immer wichtiger, da damit der Anschluss von privaten und öffentlichen Nutzern ermöglicht wird und so die andernfalls erforderlichen, erheblichen Investitionen in die Modernisierung von Heizungs- und Klimatechnik vermieden werden.
Laut dem am 31. August 2021 in Kraft getretenen Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Dabei wird in der Bundesrepublik rund die Hälfte der Energie für Wärme verbraucht. Bislang stammt Fernwärme überwiegend aus fossilen Quellen, der Anteil erneuerbarer Energien liegt bei gerade einmal 17,5 Prozent. Daraus ergibt sich großer Bedarf, die bestehenden Wärmenetze umzubauen und auf die Einspeisung von Wärme aus erneuerbaren Energien vorzubereiten. Zudem wird vielerorts die Errichtung neuer oder die Erweiterung bestehender Wärmenetze erforderlich.
Langer zeitlicher Projektvorlauf
Solche Maßnahmen sind mit erheblichen Investitionen verbunden und haben einen langen zeitlichen Projektvorlauf. Um den Umstieg auf erneuerbare Energien und die notwendigen Transformationen der Infrastruktur voranzutreiben, hat der Bundesgesetzgeber mit dem Entwurf der Richtlinie „Bundesförderung effizienter Wärmenetze“ (BEW) umfassende Mittel in Aussicht gestellt. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln wird in der Regel durch kommunale Eigenmittel sowie Fremdmittel etwa von Infrastrukturinvestoren ergänzt, um eine gesamtheitliche Projektfinanzierung sicherzustellen. Für Kommunen sind verschiedene Wege zur Strukturierung des Projekts denkbar. So ist neben einer Eigenrealisierung auch die Gründung von Kooperationen mit Dritten ein Lösungsansatz. Bei der Projektstrukturierung ist grundsätzlich zwischen der Infrastruktur- und Betreiberebene zu differenzieren. Sämtliche konzeptionellen Überlegungen müssen dabei kommunal-, vergabe- und zuwendungsrechtskonform sein, da andernfalls das Risiko einer Nichtauszahlung oder Rückforderung von Zuwendungen besteht.
Auch wenn die Kommune das Projekt in eigener Verantwortung realisieren möchte, muss zunächst bewertet werden, ob das Vorhaben von einem rechtlich unselbstständigen kommunalen Eigenbetrieb oder einer selbstständigen Organisationseinheit wie beispielsweise einem Kommunalunternehmen oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgesetzt werden soll. Dabei sollte in die Erwägungen einbezogen werden, inwiefern möglicherweise bestehende Beteiligungsstrukturen wie Gemeinde- oder Stadtwerke weiterentwickelt werden können. Die erforderlichen Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen müssen dann – sofern sie nicht in kommunaler Eigenleistung erbracht werden – in einem (europaweiten) Auswahl-/Vergabeverfahren vergeben werden.
Kooperation mit Dritten
Ein weiterer Lösungsansatz ist die Kooperation mit Dritten, also die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung mit anderen öffentlichen Stellen im Wege der interkommunalen Kooperation oder einer strategischen Partnerschaft mit einem Privatunternehmen. Zu unterscheiden ist dabei die Kooperation auf vertraglicher Grundlage und die gesellschaftsrechtliche Gründung einer gemeinsamen Organisationseinheit. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Kommunen nach Maßgabe der kommunalrechtlichen Vorgaben einen angemessenen Einfluss auf die relevanten Entscheidungen zur Umsetzung des Vorhabens haben.
Sowohl die interkommunale Kooperation als auch die strategische Partnerschaft kann auf Grundlage eines Vertrags umgesetzt werden. Während die interkommunale Kooperation bei wechselseitigen Beiträgen der öffentlichen Kooperationspartner nach § 108 Abs. 6 GWB ausschreibungsfrei ist, wird die Kooperation mit einem Privatunternehmen aufgrund der Leistungsbeziehungen in aller Regel auf vertraglicher Grundlage der vergaberechtlichen Ausschreibungspflicht unterfallen.
Die interkommunale Kooperation kann zudem im Wege einer gemeinsamen Organisationseinheit wie beispielsweise einer öffentlichen Infrastrukturgesellschaft umgesetzt werden. Bei der Kooperation mit einem Privatunternehmen in einer so genannten gemischtwirtschaftlichen Organisationseinheit handelt es sich um eine Projektgesellschaft (Joint Venture). Unter gewissen Voraussetzungen ist die interkommunale Kooperation im Rahmen einer gemeinsamen Organisationseinheit nach § 108 Abs. 1 und 4 GWB wiederum ausschreibungsfrei. Bei der Gründung einer Projektgesellschaft mit einem privaten Partner ist stets kritisch zu bewerten, ob mit der Stellung als Mitgesellschafter zugleich eine Überantwortung eines Leistungsanteils an das Privatunternehmen einhergeht. In diesem Fall ist die Begründung einer öffentlich-privaten Partnerschaft als ausschreibungspflichtiger Vorgang anzusehen.
Umsichtige Entscheidung
Kommunen haben die Möglichkeit, Wärmeprojekte unter Einbeziehung staatlicher Finanzmittel in Ergänzung zu anderweitigen Kapitalquellen zu realisieren und damit im Rahmen der Wahrnehmung einer Aufgabe der Daseinsvorsorge einen Beitrag zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele zu leisten. Dabei bieten sich verschiedene Projektstrukturen an. Die Entscheidung über eine Kooperation mit öffentlichen oder privaten Dritten sollte von der beabsichtigten strategischen Positionierung am Markt sowie der eigenen kommunalen Leistungsfähigkeit abhängig gemacht werden. In jedem Fall muss einer solchen Weichenstellung für die Projektrealisierung eine ausführliche technische, kommerzielle und rechtliche Bewertung sowie die Ableitung einer Vorlage für die Befassung der zuständigen Gremien vorausgehen, um eine umsichtige Entscheidung für solche zukunftsweisenden Projekte treffen zu können.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Mai/Juni 2022 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...
Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start
[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...