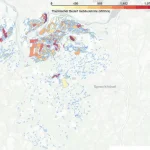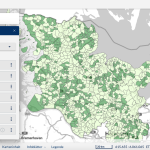DarmstadtAbwärme beheizt Staatstheater

Mit der Anbindung des Staatstheaters Darmstadt ans Fernwärmenetz geht Hessen einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Landesverwaltung.
(Bildquelle: Lottermann and Fuentes)
Das Staatstheater Darmstadt soll bis Ende 2022 an das Darmstädter Fernwärmenetz angebunden werden. Wie das Hessische Ministerium für Finanzen mitteilt, kommt dann die Wärme für Bühnen, Zuschauerräume und Büros zum größten Teil aus der Abwärme des städtischen Müllheizkraftwerks, entsteht also aus der Müllentsorgung. Dadurch sinke der Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid jährlich im Schnitt um rund 80 Prozent. Das entspreche circa 540 Tonnen weniger CO2, so viel, wie das Beheizen von etwa 110 Einfamilienhäusern verursache. Das Land Hessen, das Staatstheater Darmstadt und das Unternehmen ENTEGA STEAG Wärme (ESW) bringen das Projekt gemeinsam auf den Weg.
„Mit dem Anschluss des Staatstheaters an das Fernwärmenetz gehen wir einen weiteren Schritt hin zur CO2-neutralen Landesverwaltung. Das Land finanziert den Bau der Fernwärmetrasse mit rund 430.000 Euro“, sagt Finanzstaatssekretär Martin Worms. „Wir werden prüfen, ob dies auch für weitere Landesliegenschaften in Darmstadt sinnvoll ist und wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Die nachhaltige Fernwärmeversorgung ist ein zentraler Baustein des Versorgungskonzepts der CO2-neutralen Landesverwaltung. Rund 45 Prozent oder 289 Gigawattstunden des jährlichen Wärmebedarfs der Liegenschaften des Landes werden bereits durch umweltfreundliche Fernwärme gedeckt.“
Nachhaltigkeit gehört auch in den Heizkeller
Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, ergänzt: „Theater sind Orte der gesellschaftlichen Verständigung zu allen virulenten Themen. Hierzu gehören auch die Erderhitzung und ihre katastrophalen Folgen. Nachhaltigkeit ist längst ein Thema auf den Bühnen der Theater – und sie betrifft auch den Heizkeller. Bei der aktuellen Sanierung des Kleinen Hauses hat das Ziel der Klimaneutralität deshalb in Planung und Umsetzung einen hohen Stellenwert.“
Laut dem hessischen Finanzministerium dient die Erneuerung der Bühnentechnik des Kleinen Hauses mit einem Bauvolumen in Höhe von rund 51 Millionen Euro auch dem Ziel der Landesregierung, bis spätestens 2030 CO2-neutral zu werden. Vorangetrieben werde die Erneuerung vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH).
„Wir haben bereits gute Erfahrungen mit Fernwärme gemacht“, fügt Dorn hinzu, „die ESW versorgt schon seit 2016 den gesamten Campus der Technischen Universität Darmstadt mit Wärme, Kälte und Strom, zu wesentlichen Teilen aus dem Müllheizkraftwerk Darmstadt. Beim Bau dieser Verbindung wurden auch das Klinikum Darmstadt und das Regierungspräsidium an das Müllheizkraftwerk angeschlossen.“
Darmstadts Kämmerer André Schellenberg erläutert: „Die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt, die gemeinsam mit dem Land Hessen Träger des Staatstheaters ist, begrüßt das Vorhaben. Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ist auch für Darmstadt ein weiterer wesentlicher Baustein, um das Klimaschutzziel, bis 2035 klimaneutral zu werden, zu erreichen. Durch die Fernwärmeanbindung des Staatstheaters ergibt sich innerhalb von Darmstadt das Potenzial, auch das Quartier Mollerstadt und die auf dem Marienplatz geplante Wohnbebauung mit Fernwärme zu erschließen.“
Teil einer Pilot-Gruppe
Der Intendant des Staatstheaters, Karsten Wiegand, sagt: „Es ist uns sehr wichtig, Klimaneutralität voranzutreiben und in möglichst vielen Bereichen des Theaterbetriebs nachhaltig zu denken und zu handeln. Als Teil einer Pilotgruppe von Kulturinstitutionen in einem Projekt der Bundeskulturstiftung wurden bereits vollumfängliche Verbrauchs- und Energieberechnungen durchgeführt. Strom sparen wir durch LED-Nachrüstung und Bewegungsmelder, die Werkstätten arbeiten an einem Konzept für wiederverwendbare Bühnenbildelemente, um den Materialverbrauch zu reduzieren, und ab dieser Spielzeit sind An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Eintrittspreis enthalten.“
„Als nachhaltiger und ökologischer Energieversorger ist es uns wichtig, gemeinsam mit Partnern aus Politik und Wirtschaft dafür zu sorgen, dass unsere Region einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität leistet. Ich denke, wir sind hier – insbesondere auch in Darmstadt – auf einem sehr guten Weg“, sagt Andreas Niedermaier, Vorstand Personal und Infrastruktur der ENTEGA. „ENTEGA und STEAG arbeiten seit Jahren in dem Gemeinschaftsunternehmen ESW sehr vertrauensvoll und gut zusammen. Der Beschluss zur Anbindung des Staatstheaters Darmstadt ist ein weiterer Beweis für den Erfolg unserer Kooperation und den gemeinsamen Nachhaltigkeitsgedanken“, ergänzt Thomas Billotet, Geschäftsführer von ESW.
Fernwärmenetz jetzt 82 Kilometer lang
Nach Angaben des hessischen Finanzministeriums ist das Fernwärmenetz der ENTEGA in Darmstadt und Südhessen 81 Kilometer lang; ein Kilometer kommt mit der Anbindung des Staatstheaters Darmstadt hinzu. Es werde an das Fernwärmenetz Darmstadt-Nord angeschlossen, das sich im Wesentlichen aus der thermischen Abfallverwertung des Müllheizkraftwerks Darmstadt speist. Verbrauchsspitzen decke ein moderner Wärmespeicher der ENTEGA ab.
An das Fernwärmenetz der ENTEGA seien derzeit über 11.000 Privathaushalte, öffentliche Einrichtungen und Industrieunternehmen angebunden. Die gelieferte Fernwärme stamme hauptsächlich aus modernen Blockheizkraftwerken, die neben Strom auch nutzbare Wärme erzeugen, sowie aus dem Müllheizkraftwerk Darmstadt. So stehen aktuell rund 300 Millionen Kilowattstunden (kWh) klimaschonender thermischer Energie zur Verfügung. Zur Energieversorgung der TU Darmstadt und für den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes innerhalb Darmstadts wurde 2015 die ESW gegründet, ein Gemeinschaftsunternehmen der ENTEGA (49 Prozent Gesellschafteranteile) und der STEAG New Energies (51 Prozent Gesellschafteranteile) mit Sitz in Darmstadt. ESW ist Vertragspartner des Landes Hessen.
https://www.entega.de
https://www.steag.com
https://www.staatstheater-darmstadt.de
DStGB/PD: Praxisleitfaden für kommunale Wärmeplanung
[11.04.2025] Ein neuer Praxisleitfaden soll Städte und Gemeinden bei der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Entwickelt wurde er aus den Erfahrungen von zehn Kommunen, die bereits erste Schritte in Richtung Wärmewende gegangen sind. mehr...
rhenag: Eisspeicherprojekt in Rommerskirchen-Widdeshoven
[09.04.2025] Im nordrhein-westfälischen Rommerskirchen-Widdeshoven hat rhenag Energie ein innovatives Eisspeicherprojekt gestartet, das ein ganzes Neubaugebiet mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. mehr...
Scharbeutz: Konzept für Wärmeplanung zugestimmt
[09.04.2025] Die Gemeinde Scharbeutz hat den von Green Planet Energy entwickelten Wärmeplan beschlossen und sich damit frühzeitig zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bekannt. mehr...
NTT DATA: Wärmekonzept für Berlin-Spandau
[07.04.2025] Ein neues Wärmekonzept in Berlin-Spandau nutzt die Abwärme eines Bestandsrechenzentrums von NTT DATA zur Versorgung des Neubaugebiets Das Neue Gartenfeld. Quartierswerk Gartenfeld setzt dabei auf eine nachhaltige Lösung, die CO2-freie Wärme für mehr als 10.000 Menschen bereitstellt. mehr...
Dillingen: Weiterer Ausbau des Wärmenetzes
[03.04.2025] Die Stadt Dillingen und die energie schwaben Gruppe bauen jetzt das Wärmenetz in der historischen Altstadt weiter aus. mehr...
Stadtwerke Hattingen: Potenzialanalyse abgeschlossen
[02.04.2025] Die Stadtwerke Hattingen und das Gas- und Wärme-Institut Essen haben ihre Potenzialanalyse zur kommunalen Wärmeplanung abgeschlossen. Die Ergebnisse liefern eine fundierte Grundlage, um bis 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. mehr...
Nürnberg: Zwei Studien zur Wärmespeicherung
[31.03.2025] Saisonale Wärmespeicher könnten eine zentrale Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen. Zwei Studien der FAU Erlangen-Nürnberg und der TH Nürnberg Georg Simon Ohm analysieren, welche Technologien und Speichergrößen für den Energieversorger N‑ERGIE wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind. mehr...
MVV: Flusswärmepumpe in Planung
[24.03.2025] Das Mannheimer Energieunternehmen MVV plant eine der größten Flusswärmepumpen Europas. Die neue Anlage soll ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen und durch einen wasserstofffähigen Fernwärmenachheizer ergänzt werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Stand zur Wärmeplanung
[24.03.2025] Zwei Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen haben bereits mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans begonnen. mehr...
GISA: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentrum
[21.03.2025] Der IT-Dienstleister GISA nutzt künftig die Abwärme seines Rechenzentrums in Halle (Saale), um Büros zu temperieren. Dies spart Energie, reduziert den CO₂-Ausstoß und macht die Cloudleistungen des Unternehmens nachhaltiger. mehr...
Ibbenbüren: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen
[20.03.2025] Die Stadt Ibbenbüren hat als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und stellt damit die Weichen für die lokale Wärmewende. mehr...
Borkum: Wärmeplanung gestartet
[19.03.2025] Die Insel Borkum hat jetzt gemeinsam mit der Energielenker Gruppe die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist eine nachhaltige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung, die sowohl den Tourismus als auch die Lebensqualität der Bewohner stärkt. mehr...
KEA-BW: Wärmeatlas BW ist online
[19.03.2025] Der neue Wärmeatlas Baden-Württemberg bietet Kommunen eine detaillierte Übersicht über den Wärmebedarf von Gebäuden und unterstützt sie bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. mehr...
Frankfurt am Main: Wärmeplan soll 2026 vorliegen
[17.03.2025] Die Stadt Frankfurt hat den Energieversorger Mainova, das Fraunhofer-Institut IFAM, e-think-energy research und IREES mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt. Die Unternehmen sollen eine zukunftsweisende Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Mainmetropole entwickeln. mehr...
Schleswig-Holstein: Wärmekompetenzzentrum und -potenzialkarten gehen an den Start
[14.03.2025] Mit dem neuen Wärmekompetenzzentrum und den Wärmepotenzialkarten erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein gezielte Unterstützung bei der kommunalen Wärmeplanung. Während das Wärmekompetenzzentrum die Gemeinden beratend begleitet, bieten die Wärmepotenzialkarten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich tragfähige Wärmenetze. mehr...