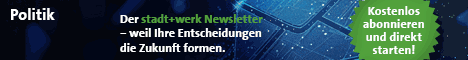Energieeffizientes BauenAachen setzt Standards

Die Stadt Aachen will den Gebäudebestand auf ein nachhaltig energetisches Niveau anhaben und hat dazu klare Standards definiert.
(Bildquelle: creativ collection Verlag)
Als ökologische Stadt der Zukunft hat sich Aachen im Bereich der Gebäudeeffizienz schon vor Jahren eigene Maßstäbe gesetzt, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgingen. Damit konnte im Zeitraum 2002 bis 2008 der Wärmeverbrauch der kommunalen Gebäude um 30 Prozent gesenkt werden. Als dann im Jahr 2009 vom Bund im Rahmen des Konjunkturpakets II zehn Milliarden Euro für kommunale Investitionen in den Bereichen Bildung und Klimaschutz zur Verfügung gestellt wurden, hat das Gebäude-Management der Stadt Aachen dies als einmalige Chance begriffen, um die Qualität des Bauens und Sanierens auf einen nachhaltigen energetischen Standard anzuheben.
Im Februar 2010 wurde daher mit den Planungsanweisungen für städtische Gebäude, Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen der Aachener Standard verbindlich festgeschrieben. Dieser wurde abweichend vom zertifizierten Passivhaus mit einem jährlichen Heizwärmebedarf von weniger als 20 kWh/m²h definiert. Auf eine Zertifizierung als Passivhaus, welches einen Heizwärmebedarf von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr nicht überschreiten darf, wurde verzichtet. Damit sollte der Nachhaltigkeit aller Bauteile gegenüber technisch noch nicht ausgereiften Produkten oberste Priorität eingeräumt werden. Der Aachener Standard beinhaltet eine wirtschaftliche und nachhaltige Konzeption mit sehr guter Wärmedämmung, Minimierung von Wärmebrücken und einer Lüftungsanlage mit hohem Wärmerückgewinnungsgrad. Ebenfalls festgeschrieben wurde, dass Lüftungsanlagen bei umfassenden Sanierungen von Schulen zwingend zur Erreichung einer hygienischen Luftqualität eingesetzt werden müssen. Damit gilt Aachen unter den Kommunen durchaus als Vorreiter beim Thema Luftqualität und machte zudem erste Erfahrungen auf dem Weg zum Passivhaus.
Planen nach Aachener Standard
Das hochwertige Gebäudekonzept Aachener Standard macht es notwendig, dass alle Planer gemeinsam ein tragfähiges Gesamtkonzept erarbeiten. Denn die Ziele gute Architektur- und Nutzungsqualität, wirtschaftliche Bauweise und angestrebter energetischer Standard können nur dann zusammengebracht werden, wenn sie von Anfang an parallel berücksichtigt werden. Für alle Neubauten nach Aachener Standard wird ein Nachweis nach Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP) erstellt. Zu den Anforderungen zählen dabei insbesondere folgende:
● Jahresheizwärmebedarf < 20 kWh/(m²a),
● Primärenergiebedarf < 120 kWh/(m²a), inklusive gesamter Strombedarf,
● Wärmebrücken < 0,05 W/m²K,
● Drucktestluftwechsel n50: max. 0,6/h-1.
Energetisch hochwertige Gebäude, so auch Gebäude nach Aachener Standard, müssen zudem folgende generelle Ausführungsprinzipien erfüllen:
Hüllflächenprinzip: Eine kompakte Bauform ist energetisch günstig. Eine einfache Geometrie der beheizten Zonen des Gebäudes und eine klare Definition des beheizten Volumens sind entscheidend für die energetische Konzeption.
Homogenitätsprinzip: Eine möglichst einheitliche Dämmqualität ist wichtig. Die Übergangsdetails erfordern eine besonders sorgfältige Planung.
Wärmebrückenfreiheit: Es wird Wärmebrückenfreiheit angestrebt. Der außenmaßbezogene Wärmebrückenverlustkoeffizient von Anschlüssen und Bauteilübergängen sollte ≤ 0,01 W/mK sein.
Luftdichtheit: Die luftdichte Ebene muss lückenlos sein. Das Prinzip innen dicht, außen diffusionsoffen ist entscheidend für die energetische Qualität, für die Schadensfreiheit und auch für die Behaglichkeit.
Solare Gewinne: Die Wechselwirkung von solaren Gewinnen und Verlusten aufgrund der gegenüber Wandquerschnitten schlechteren Wärmeleitfähigkeiten ist im Sinne einer optimalen Nutzung auszubalancieren. Dabei ist darauf zu achten, dass es nicht zu Überhitzungen kommt. Technische Kühlung sollte aufgrund des hohen Energiebedarfs vermieden werden.
Nachhaltig sanieren
Auch bei der Sanierung der kommunalen Gebäude wird in Aachen ein hochwertiger, nachhaltiger Standard angestrebt. Dieser wird beeinflusst durch die baulichen Gegebenheiten des Bestandsgebäudes, wie beispielsweise ein eventuell ungünstiges Volumen-/Flächenverhältnis, oder den Vorgaben des Denkmalschutzes. Das Volumen-/Flächenverhältnis sollte, sofern es mit der Entwurfsidee zu vereinbaren ist, optimiert werden, etwa durch Überbauung eines Innenhofes. Darüber hinaus empfiehlt der Aachener Standard für Sanierungen, vor Haupteingängen möglichst unbeheizte Windfänge als Pufferzonen zu planen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten der sanierten Bauteile sind je nach technischen Möglichkeiten und Situation strenger als die gesetzlichen Vorgaben. Beim Einbau von neuen (dichteren) Fenstern ist außerdem ein Lüftungskonzept zu erstellen, um eine Verschlechterung der Raumluftqualität und damit verbundene Feuchteschäden zu vermeiden. Die sicherste Lösung ist hier eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.
#bild2 Zu Beginn jeder energetischen Sanierung steht eine genaue Bestandsaufnahme des Ist- Zustandes des betreffenden Gebäudes. Dazu gehören die Auswertung der Planunterlagen, die Abklärung bereits erfolgter Sanierungen und die Öffnung der nicht einsehbaren Bestandskonstruktionen, wie zum Beispiel das Aufschneiden der Flachdachabdichtung mit Feststellung der Dämmstärke und des Zustands der Dämmung oder die Überprüfung der Luftschichtstärke in der zweischaligen Wandkonstruktion.Bei umfangreichen Sanierungen ist zudem eine Bilanzrechnung des Ist-Zustandes nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) unter Berücksichtigung der geplanten Sanierungsmaßnahmen notwendig. Dabei wird der Ist-Zustand unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verbrauchswerte mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen verglichen. Nach dem Aachener Standard ist ab einer Sanierung von mindestens drei Bauteilen das energetische EnEV-Niveau 2009 für Bestandsgebäude anzustreben. Bei vollständigen Sanierungen aller Bauteile und der Haustechnik ist sogar das EnEV-Niveau 2009 für Neubauten zu erreichen. Mithilfe der Energiebilanz kann die Effizienz unterschiedlicher Bauteilqualitäten ermittelt werden, was nützlich bei Materialentscheidungen sein kann. Die Bilanz wird, noch bevor alle Materialien feststehen, im Entwurfsstadium erstellt und dient als Unterstützung der Kosten- und Ausführungsplanung sowie der Ausschreibung. Die Vorbildfunktion, die das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz für Kommunen seit Mai 2011 bei Sanierungen vorgibt, liegt auf einem ähnlichen Niveau.
Geregelt bis ins Detail
Bei einer qualitativ hochwertigen Sanierung spielen Details eine große Rolle. Für alle Bauteile, wie etwa Fenster, beinhaltet der Aachener Standard daher genaue Ausführungshinweise. So ist beispielsweise beim Austausch vorhandener Fenster in jedem Fall deren Gliederung auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Das Fenster muss dabei folgende vielfältige Funktionen erfüllen: Belichtung, Lüftung, Wärmeschutz, Gestaltung, Bedienungshöhe Griff, Unfallschutz, Fensterreinigung, eventuell Schallschutz und Fluchtweg.
Der effiziente Austausch verbrauchter Raumluft ist entscheidend für einen sparsamen Energieverbrauch. Das gilt für Gebäude mit und ohne Lüftungsanlage. Eine Lüftungsanlage kann ausfallen oder der Betrieb wird im Sommer eingeschränkt. Daher muss eine ausreichend große Fensteröffnungsfläche vorhanden sein, um in möglichst kurzer Zeit einen vollständigen Luftaustausch zu gewährleisten. Der Aachener Standard gibt als Faustregel eine freie Fensterfläche von drei Prozent vor. Diese Maßgabe ist bezogen auf das Raumvolumen und liegt auf etwa dem gleichen Niveau wie die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien. Um den Aachener Standard zu erreichen, ist außerdem eine Dreifachverglasung notwendig. Bei Fensterflügeln, die von kleineren Kindern bewegt werden sollen, ist zu berücksichtigen, dass das Glasgewicht durch die Dreifachverglasung um etwa zehn kg/m² erhöht ist. Die Größe der Fensterflügel ist dem anzupassen, um eine Quetschgefahr zu vermeiden.
Absolut luftdicht
Außerdem ist die erhöhte mechanische Belastung der Fensterflügel zu berücksichtigen. Die Uw-Werte für Fenster werden daher auf maximal 1,00 W/(m²K) festgelegt. Jeder Flügel, jedes Kämpferprofil, jede Sprosse verschlechtert den Wert.Regelungen trifft der Aachener Standard auch für den Einbau von Fenstern und Außentüren. So muss der Fenster- und Türeinbau neben der statischen Kraftübertragung und der Regendichtigkeit auch einen Wärmeschutz in Fensterebene und eine absolute Luftdichtigkeit von innen gewährleisten. Es sind inzwischen Abdichtungssysteme auf dem Markt, die zwei Funktionen mit einem Material erfüllen; in jedem Fall müssen stets alle drei Funktionen gewährleistet sein. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Bauteil Fenster ist die Laibungsdämmung. Werden etwa in Denkmalobjekten ausschließlich die Fenster bei einer Sanierung erneuert, ohne dass die Außenwände eine Außendämmung erhalten, müssen die Laibungen von innen gedämmt werden. Ein wichtiges anzustrebendes Qualitätsmerkmal ist zudem die perfekte Luftdichtheit. Das Prinzip innen dicht, außen diffusionsoffen ist entscheidend für die energetische Qualität.
Deutlich über dem Mindestmaß
Mit den Planungsanweisungen hat die Stadt Aachen für ihre kommunalen Bauaufgaben im Bereich Neubau und Sanierung einen Standard geschaffen, der deutlich über dem gesetzlichen Mindestmaß liegt. Damit soll einerseits im Hinblick auf zukünftige gesetzliche Zielsetzungen ein Vorsprung erreicht und anderseits ein wirklich nachhaltiges Bauen umgesetzt werden.
Dieser Beitrag ist in der November-Ausgabe von stadt+werk im Schwerpunkt Energieeffizientes Bauen erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
BMWSB: Neustart von Förderprogramm
[01.12.2025] Nach einem Jahr Förderpause startet das Programm Energetische Stadtsanierung erneut und unterstützt Kommunen beim klimafreundlichen Umbau ihrer Quartiere. Laut Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen stehen 2025 wieder umfangreiche Mittel für Konzepte und Sanierungsmanagement bereit. mehr...
LENA: Bauherrenmappe feiert Jubiläum
[01.12.2025] Seit zehn Jahren dient die Bauherrenmappe Sachsen-Anhalt als kostenloser Leitfaden für private Bau- und Sanierungsprojekte. Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt blickt zum Jubiläum auf ein Jahrzehnt kontinuierlicher Aktualisierung und Beratung zurück. mehr...
Trier: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
[28.11.2025] Die Stadt Trier hat ihre gesamte Straßenbeleuchtung schneller als geplant auf vernetzte LED-Technik umgestellt und senkt damit deutlich den Energieverbrauch. Das neue System ermöglicht zudem eine zentral gesteuerte, bedarfsgerechte Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet. mehr...
Energieatlas Rheinland-Pfalz: Zehnjähriges Jubiläum
[27.11.2025] Der Energieatlas Rheinland-Pfalz feiert sein zehnjähriges Bestehen und erscheint jetzt in einem neuen Design. Das Datenportal gilt als zentrales Werkzeug für die Analyse regionaler Energiewende-Fortschritte. mehr...
beegy: Mit HEMS Eigenversorgung steuern
[05.11.2025] Sinkende Einspeisevergütungen lenken den Fokus privater PV-Anlagen zunehmend auf den Eigenverbrauch. Laut beegy können intelligente Heim-Energiemanagementsysteme die Wirtschaftlichkeit für Prosumer deutlich steigern. mehr...
Nordrhein-Westfalen: Förderung energieeffizienter Schulgebäude
[28.10.2025] Nordrhein-Westfalen und die Europäische Union fördern den Bau energieeffizienter Schulgebäude mit rund 43 Millionen Euro aus dem EFRE/JTF-Programm. Das Land will damit moderne Lernorte schaffen und zugleich die Energiekosten der Kommunen senken. mehr...
Konstanz: Entwicklung eines Szenarieneditors
[28.10.2025] In Konstanz entsteht derzeit eine digitale Anwendung, die die Energieplanung auf Quartiersebene erleichtern soll. Im Rahmen des Smart-Green-City-Projekts entwickelt die Universität Konstanz gemeinsam mit Stadt und Stadtwerken einen sogenannten Szenarieneditor, mit dem sich verschiedene Energieversorgungskonzepte simulieren und vergleichen lassen. mehr...
Herten: Umrüstung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen
[28.10.2025] Nach rund sechseinhalb Jahren ist die LED-Umrüstung der Hertener Straßenbeleuchtung abgeschlossen. Mehr als 7.000 Laternen im Stadtgebiet leuchten nun energieeffizient und klimafreundlich. mehr...
Neubrandenburger Stadtwerke: Kooperation mit Handwerksunternehmen
[15.10.2025] Die Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) haben eine Energiepartnerschaft mit nb-haustechnik und Buderus geschlossen. Ziel ist es, Hauseigentümern im Raum Neubrandenburg klimafreundliche Komplettlösungen für Wärme, Strom und Mobilität aus einer Hand anzubieten. mehr...
NRW.Energy4Climate: Auszeichnung von vier Bauprojekten
[29.09.2025] Vier Bauprojekte im Rheinland sind von der Landesregierung für ihre besondere Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit ausgezeichnet worden. Geehrt wurden eine Wohnsiedlung, zwei Schulen und ein Bürogebäude, die mit innovativen Konzepten zur Wärmewende beitragen. mehr...
Bremen: Neue Zentrale versorgt Quartier CO2-frei
[24.09.2025] Im Bremer Gewerbequartier Spurwerk ist eine neue Energiezentrale offiziell in Betrieb gegangen. Der Energiedienstleister swb hat die Anlage heute vorgestellt. Sie versorgt das Quartier mit Wärme und Kälte – und das ganz ohne Gas oder Öl. mehr...
Dresden/Leipzig: CO₂-Rechner für Kultur mit neuen Funktionen
[27.08.2025] Kultureinrichtungen in Deutschland können ab sofort das E-Tool Kultur in erweiterter Form nutzen. Der CO₂-Rechner ist von der Zertifizierungsstelle GUTcert geprüft und mit neuen Funktionen ausgestattet. mehr...
Würzburg: Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude
[21.08.2025] Die Stadt Würzburg lässt ihre öffentlichen Gebäude systematisch energetisch sanieren. Der Fahrplan soll bis 2028 eine klimaneutrale Verwaltung ermöglichen und langfristig Energie- wie auch Kostenersparnisse sichern. mehr...
Hessen: Projekt zu Energiemonitoring erhält Förderung
[05.08.2025] Mit einem neuen Förderprojekt zur intelligenten Steuerung von Straßenlaternen und dem digitalen Energiemanagement kommunaler Gebäude wollen drei osthessische Gemeinden Energie sparen und Emissionen senken. Das Land Hessen unterstützt das Vorhaben mit über 740.000 Euro aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“. mehr...
Hamburger Energienetze: Weitere Aufträge für Energieeinsparungen
[29.07.2025] Dank digitaler Heizungsoptimierung konnten städtische Gebäude in Hamburg ihren Energieverbrauch deutlich senken. Nach erfolgreichen Pilotprojekten beauftragen Sprinkenhof und der Bezirk Bergedorf die Hamburger Energienetze mit weiteren Maßnahmen. mehr...